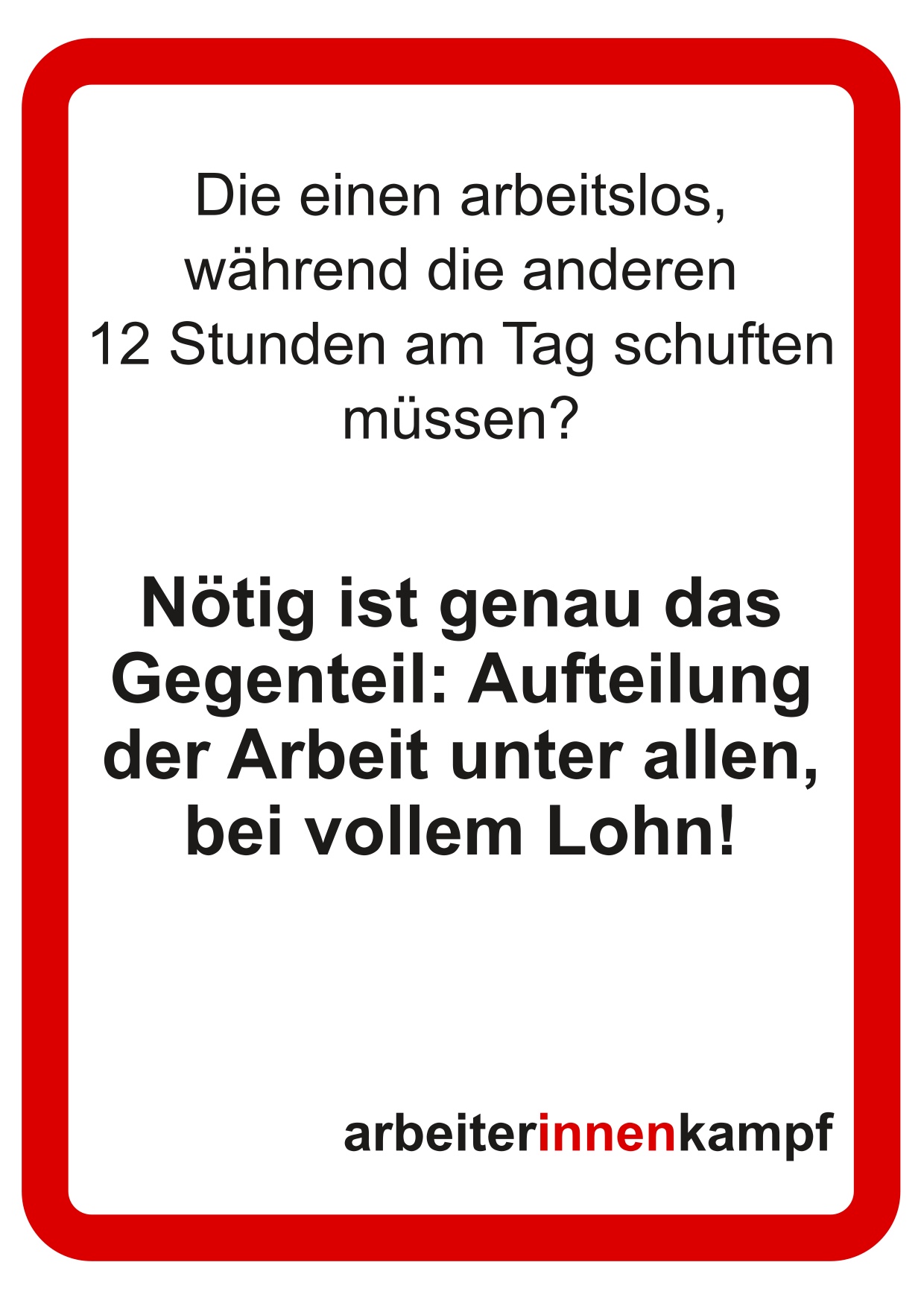80 Jahre Februarkämpfe 1934
12. Februar 2014
Mitte Februar vor 80 Jahren haben Schutzbundkämpfer und andere Arbeiter/innen versucht, die Errichtung des austrofaschistischen Ständestaates doch noch zu verhindern. Ohne politische und organisatorische zentrale Führung endete dieser heldenhafte Kampf in der Niederlage. Die Aufgabe neuer Generationen von Aktivist/innen der Arbeiter/innenbewegung ist es, das Andenken an die Kämpfer/innen von damals zu bewahren und die Lehren aus ihrem Kampf zu ziehen.
Als am Morgen des 12. Februar 1934 Angehörige des sozialdemokratischen Schutzbundes in Linz sich offen gegen eine provokative Waffensuche der christlich-sozialen Heimwehren zur Wehr setzten, lösten sie den letzten Abwehrkampf der österreichischen Arbeiter/innenbewegung vor dem Zweiten Weltkrieg aus, der sich der Etablierung der offen reaktionären Diktatur entgegenstemmen sollte.
Damit hatte ein zu diesem Zeitpunkt bereits nur noch schwer gewinnbarer Kampf begonnen, der innerhalb von kurzer Zeit, innerhalb weniger Tage, die Arbeiter/innenbewegung endgültig in die Illegalität trieb. Über die Trümmer der österreichischen Sozialdemokratie hinweg war der Weg frei geworden zur Etablierung des schwächlichen austrofaschistischen Ständestaates nach dem Muster des italienischen Faschismus - es war aber auch der Weg, der nach nur vier Jahren Österreich den Angriffen des Nationalsozialismus wehrlos ausliefern sollte.
Wie war es möglich, dass die österreichische Sozialdemokratie, der Stolz der II. Internationale und eine der stärksten sozialdemokratischen Parteien überhaupt - wie war es möglich, dass diese Partei in die Illegalität getrieben werden konnte? Wie war es möglich, dass diese Partei, deren Anspruch des war, die bürgerliche Demokratie gegen die Angriffe von links und rechts zu verteidigen, nun selbst nicht nur die letzten Reste der Demokratie aufgeben musste, sondern auch selbst der Legalität beraubt wurde? Sicher, die Partei hatte es mit einem Gegner zu tun, der seit Jahren keinen Zweifel daran gelassen hatte, dass sein eigentliches Ziel die Beseitigung eben dieser Demokratie sei. So hatte es im Korneuburger Eid der christlich-sozialen Heimwehren am 18. Mai 1930 unmissverständlich geheißen:
"Wir wollen Österreich von Grund aus erneuern! Wir wollen den Volksstaat der Heimatwehren. [...] Wir wollen nach der Macht im Staate greifen und zum Wohle des gesamten Volkes Staat und Wirtschaft neu ordnen. [...] Wir verwerfen den westlichen demokratischen Parlamentarismus und den Parteienstaat! [...] Wir kämpfen gegen die Zersetzung unseres Volkes durch den marxistischen Klassenkampf und die liberal-kapitalistische Wirtschaftsgestaltung. [...] Der Staat ist die Verkörperung des Volksganzen, seine Macht und Führung wacht darüber, dass die Stände in die Notwendigkeiten der Volksgemeinschaft eingeordnet bleiben. Jeder Kamerad [...] erkenne die drei Gewalten: den Gottesglauben, seinen eigenen harten Willen, das Wort seiner Führer!"
Bundeskanzler Engelbert Dollfuß hatte in einem Brief an Mussolini am 22. Juli 1933 auch klar die Marschrichtung skizziert: "Was die von Eurer Exzellenz betonte Notwendigkeit der baldigen Einführung innerer Reformen im Sinne einer berufsständischen und autoritären Verfassung betrifft, so teile ich durchaus die Auffassung Eurer Exzellenz." Er sei "unablässig bemüht, den Boden für die Aufrichtung des meiner Überzeugung nach meinem Lande am besten zusagenden straffen Autoritätsregimes vorzubereiten. Es ist klar, dass zunächst viel Schutt, der sich in den Jahren seit dem Bestande der Republik angehäuft hat, weggeräumt werden muss."
Das waren alles andere diplomatische Floskeln, die als nur im Geheimen gegebene Versprechungen gewertet werden mussten. Die Ziele lagen klar am Tisch - und wurden Ende Jänner / Anfang Februar 1934 auch gar nicht mehr vor dem Gegner geheim gehalten: Am 9. Februar 1934 sagte Ernst Rüdiger von Starhemberg, österreichischer Heimwehr-Führer, in einem Zeitungsinterview: "Die Tiroler Aufstandsbewegung, die ganz Österreich erfasst, stellt sich das Ziel, jedweder Demokratie in Österreich ein für allemal ein Ende zu machen." Am Tag darauf zerstreute Bundeskanzler Dollfuß die Besorgnisse der Heimwehr, er könne vielleicht noch zurückziehen. Zur Bestätigung wurden alle Bezirksobmänner des Schutzbundes, der damals bereits verbotenen Wehrorganisation der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, verhaftet. Und am 11. Februar kündigte Vizekanzler Fey bei einer Gefechtsübung der Heimwehr bei Strebersdorf den Kampf an: "Ich kann Euch beruhigen: Die Aussprachen von vorgestern und gestern haben uns die Gewissheit gegeben, dass Kanzler Dr. Dollfuss der unsrige ist. Ich kann Euch noch mehr, wenn auch nur mit kurzen Worten, sagen: Wir werden morgen an die Arbeit gehen, und wir werden ganze Arbeit leisten."
Vor diesem Hintergrund mutet es auf den ersten Augenblick seltsam an, dass der Aufstand des österreichischen Schutzbundes in Linz ausbrach und nicht zentral angeleitet wurde. Angesichts der Klarheit der Ziele des Gegners und der völlig offen kommunizierten Pläne zur Zerschlagung von bürgerlicher Demokratie und legaler Arbeiter/innenorganisationen wäre doch auf den ersten Blick zu erwarten gewesen, dass die sozialdemokratischen Parteiführer selbst das Signal zum Losschlagen gegeben und an der Spitze des Aufstandes gestanden hätten. Alles das wäre auf den ersten Blick zu erwarten gewesen - hatten doch die Parteigranden von Parteiführer Otto Bauer bis zum Schutzbundkommandanten Julius Deutsch immer unmissverständlich die härtesten Gegenmaßnahmen im Falle reaktionärer Übergriffe gegen die Partei und die Arbeiter/innen/bewegung angekündigt.
Doch letzten Endes waren die radikalen Worte der Parteiführung nur der trügerische Schein. Die Sozialdemokratie war eben keine grundsätzliche Alternative zu bürgerlicher Ordnung und kapitalistischer Gesellschaft.
Die abgewürgte österreichische Revolution 1918/1919
Am 21. Oktober 1918 hatte sich im Angesicht der zusammenbrechenden Habsburger-Monarchie die deutschsprachigen Mitglieder des Reichsrates, also des Parlaments des österreichischen Reichsteiles der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn, als "Provisorische Nationalversammlung für Deutschösterreich" konstituiert. Am 30. Oktober nahm diese "Provisorische Nationalversammlung" einen Verfassungsentwurf des Sozialdemokraten Karl Renner an und wählte einen Staatsrat mit drei Präsidenten, dem Deutschnationalen Franz Dinghofer, dem Christlich-Sozialen Prälat Johann Hauser und dem Sozialdemokraten Karl Seitz.
Damit war die Marschroute bereits skizziert, die das Handeln der Sozialdemokratie in der Ersten Republik bestimmen sollte: Die Führung der SdAP hatte sich auf eine Zusammenarbeit mit den bürgerlichen Kräften festgelegt und sollte in der stürmischen Nachkriegszeit diese Koalitionspolitik auch gegen alle Versuche von links verteidigen, dieser strategischen Ausrichtung auf eine Klassenkollaboration eine klassenkämpferische Alternative entgegenzustellen. Der Sozialdemokratie kam dabei anfänglich die starke Stellung der Arbeiter/innen/bewegung zugute. Die soziale Verelendung im Ersten Weltkrieg und die Diskreditierung der offen bürgerlichen Parteien, die russische Revolution und das wachsende Selbstbewusstsein des Proletariats auch in Österreich - alles das hatte dazu geführt, dass von bürgerlicher Seite an die Arbeiter/innen/bewegung gewichtige Konzessionen gemacht werden mussten, um die Arbeiter/innen/bewegung vor einem Abdriften auf eine Perspektive wie in Russland abzuhalten.
So konnte das allgemeine, gleiche und geheime Wahlrecht unabhängig vom Geschlecht, die Abschaffung der Zensur, aber auch soziale Rechte wie Acht-Stunden-Tag, Urlaubsanspruch auch für Arbeiter/innen, Regelung des Kollektivvertragsrechts, Errichtung der Arbeiterkammern, Schaffung von Betriebsräten erkämpft werden - genauer gesagt: "erkämpfen" ist nicht das richtige Wort, die sozialen und politischen Verbesserungen waren in erster Linie das Ergebnis der Angst der bürgerlichen Kräfte vor "Chaos" und Kommunismus, vor einem Übergreifen der revolutionären Welle auch auf Österreich, die sie dazu brachten, lang gehegte Forderungen der organisierten Arbeiter/innen/bewegung recht problemlos zu erfüllen. Die Reformen wurden durch Abstimmungen im Parlament auf konsensualem Wege, und durch die sanfte Drohung mit dem Druck der Straße, erzwungen - es war der "revolutionäre Schutt", den die nachfolgenden bürgerlichen Regierungen (nun schon ohne Sozialdemokraten) wegräumen wollten.
Ein Ergebnis dessen war aber auch, dass die austromarxistischen Maxime, sich auf Wahlerfolge zu konzentrieren, einem großen Teil der Arbeitenden als erfolgversprechender erschien als der schrille Aktionismus der frühen KP, die - von den Massen isoliert - sich in linksradikalem Pathos übte. Waren nicht wirklich die sozialen Verbesserungen und die politischen Erfolge wie das Wahlrecht auch für die Frauen, ohne blutige Klassenkämpfe im Parlament abgesegnet worden? Im Unterschied dazu waren der Einführung des allgemeinen Männerwahlrechts in der Monarchie noch gewaltige Massendemonstrationen vorausgegangen. Hatte Otto Bauer nicht recht, wenn er vollmundig tönte, dass 50 Prozent und eine Stimme genügen würden, um in Österreich auf friedlichem Wege den Sozialismus einzuführen; und sollte sich gegen dieses eindeutige Votum des Wahlvolkes die Bourgeoisie wehren, dann – aber dann ganz bestimmt – werde man sie in ihre Schranken weisen, bis dahin müssten sich die Arbeitenden eben in Geduld üben, es könne ohnehin nicht mehr lange dauern...
Otto Bauer legte in seinem grundlegenden Werk "Die österreichische Revolution" (1923) zur Errichtung der österreichischen Republik 1918 die starke Position der Arbeiter/innen/bewegung offen - er zeigte damit aber auch, was theoretisch möglich gewesen wäre:
"Die Regierung stand damals immer wieder den leidenschaftlichen Demonstrationen der Heimkehrer, der Arbeitslosen, der Kriegsinvaliden gegenüber. Sie stand der vom Geiste der proletarischen Revolution erfüllten Volkswehr gegenüber. Sie stand täglich schweren, Gefahr drohenden Konflikten in den Fabriken, auf den Eisenbahnen gegenüber. Und die Regierung hatte keine Mittel der Gewalt zur Verfügung: Die bewaffnete Macht war kein Instrument gegen die von revolutionären Leidenschaften erfüllten Proletariermassen. (...) Keine bürgerliche Regierung hätte diese Aufgabe bewältigen können. Sie wäre wehrlos dem Misstrauen und dem Hass der Proletariermassen gegenübergestanden. Sie wäre binnen acht Tagen durch Straßenaufruhr gestürzt, von ihren eigenen Soldaten verhaftet worden. Nur Sozialdemokraten konnten diese Aufgabe von beispielloser Schwierigkeit bewältigen. Nur ihnen vertrauten die Proletariermassen. (...) Nur Sozialdemokraten konnten wild erregte Demonstrationen durch Verhandlungen und Ansprachen friedlich beenden, nur Sozialdemokraten konnten sich mit den Arbeitslosen verständigen, die Volkswehr führen, die Arbeitermassen von der Versuchung zu revolutionären Abenteuern (...) abhalten. Die Funktion, die damals die wichtigste Funktion der Regierung war, konnte nur von Sozialdemokraten erfüllt werden. Die tiefe Erschütterung der bürgerlichen Gesellschaftsordnung fand darin ihren anschaulichsten Ausdruck, dass eine bürgerliche Regierung, eine Regierung ohne Sozialdemokraten schlechthin unmöglich geworden war."
Niemals, weder vorher noch nachher, war das österreichische Proletariat einer sozialen Revolution näher als im Winter und Frühjahr 1918/1919. Große Teile der Arbeiter/innen/schaft in Österreich wären für eine sozialistische Perspektive zu gewinnen gewesen. "Machen wir's wie in Russland" war eine gängige Parole in jenen Tagen, und die kapitalistischen Kräfte wussten, dass breite Teile der Arbeitenden diese Parole auch ernst nahmen.
Otto Bauer zeigt mit entwaffnender Offenheit in dem obigen Zitat die subjektiven Möglichkeiten, aber auch die objektive Funktion der SP in den bewegten Tagen der Jahre 1918/1919, als die Mittelmächte kapitulieren mussten und die Kriegsheimkehrer, die Invaliden, die Arbeitslosen auf die Straße gingen und sich immer größere Massen an der russischen Revolution orientierten. Die Parteiführung der Sozialdemokratie und ihre Fähigkeit, die Massen nach wie vor hinter sich zu versammeln, war für das Überleben des Kapitalismus in dieser krisenhaften Situation entscheidend.
Ausverkauf der Arbeiter/innen/interessen in der 1. Republik
In den kommenden Jahren sollte sich an dieser Funktion nichts Grundlegendes ändern: Die sozialdemokratische Parteiführung hielt eisern an einer Reformperspektive innerhalb des kapitalistischen Systems fest und versuchte diese mit allen Mitteln gegen linke Kritik zu verteidigen. Ihre strategische Ausrichtung war strikt innerhalb des Systems angelegt; die Funktion der Reden vom Sozialismus - auch wenn wir Otto Bauer nicht absprechen wollen, dass er sie ernst meinte - war letztlich die, die Arbeiter/innen/basis zu beruhigen und ihren diffusen Wünschen nach einer grundlegenden Alternative entgegen zu kommen.
Aber vielleicht war die Parteiführung 1918/1919 überrumpelt worden? Vielleicht ging alles nach dem Zusammenbruch der Donaumonarchie viel zu schnell? Vielleicht brauchte der Austro-Marxismus nur etwas mehr Zeit, um zu lernen und eine geeignete Strategie für den Kampf um den Sozialismus zu entwickeln? Der 15. Juli 1927 hätte noch einmal eine gute Chance geboten, zuzugreifen und die Macht der Reaktion zu zerschlagen. Am 30. Januar 1927 war es im burgenländischen Schattendorf wieder einmal zu einem Zusammenstoß von Schutzbund und "Frontkämpfern" gekommen. Mitglieder dieser nationalistischen, reaktionären Vereinigung beschossen aus einem Gasthaus heraus vorbeimarschierende Schutzbündler - ein vierzigjähriger Kriegsinvalide und ein achtjähriger Junge wurden erschossen. Die Partei antwortete mit Protestkundgebungen und Streiks der Arbeiter/innen/schaft.
Am 15. Juli 1927 wurden die Mörder vor dem Wiener Landesgericht freigesprochen. Die Arbeitenden reagierten empört, aber der Schutzbund wurde nicht mobilisiert, ebenso wenig lagen Instruktionen des Parteivorstandes vor. Das SP-Zentralorgan "Arbeiter-Zeitung" antwortete wie auch sonst mit einem radikalen Leitartikel - doch diesmal wirkte dieser nicht wie sonst als Beruhigung, dass der Parteivorstand noch angemessen reagieren werde, sondern als Fanal, sich nun endlich zu wehren. Spontan wurde die Arbeit niedergelegt, Tausende marschierten in die Wiener Innenstadt - der Justizpalast ging in Flammen auf, die Polizei schoss in die Menge, das Ergebnis waren 85 tote Demonstrant/inn/en (neben 4 toten Polizisten) und etwa 1.000 Verletzte, viele davon mit Schusswunden. Doch auch diesmal wiegelte die Parteispitze ab und reagierte mit dem Angebot einer Koalitionsregierung mit den "vernünftigen" Kräften der Bourgeoisie...
Bis 1934 blieb dieses Grundmuster austromarxistischer Politik erhalten: Der radikalen Phrase folgte stets eine kleinlaute Beschwichtigung der Massen und ein Angebot an die vernünftigen Gegner - um im nächsten Atemzuge gleich wieder zu betonen: WENN aber die Bourgeoisie die Demokratie angreift, DANN werden wir mit aller Kraft reagieren... Das Linzer Programm der SdAP von 1926 hat diese Methode kanonisiert und in das altbekannte System gebracht: Wir sind gegen die Gewalt, aber wenn die Bourgeoisie mit Gewalt die Demokratie angreift, dann stehen wir auch Gewehr bei Fuß und werden mit Gewalt antworten. Und als das Parlament 1933 von Dollfuß heimgeschickt wurde, reagierte die Parteiführung damit, WENN die Partei verboten und das Rote Wien, der Stolz der Partei, angetastet würde, dann - DANN aber wirklich - werde die Partei unbarmherzig zurückschlagen. Wenn jedoch der Linzer Schutzbundführer Richard Bernaschek nicht ohne Rücksprache mit der Parteileitung in Wien eigenmächtig das Signal zur Abwehr gegeben hätte, dann hätte auch der Abwehrkampf des 12. Februar 1934 nicht stattgefunden... Denn die sozialdemokratische Parteiführung predigte in den letzten Jahren bis zum Februar 1934 dem Schein nach zwar unermüdlich den unbarmherzigen Kampf in der Zukunft und unter ganz klar definierten Bedingungen - und hielt die Arbeitenden damit ab, eigene Wege zu gehen. Sie wurden auf den Moment vertröstet, als es für einen erfolgreichen Kampf - letztlich schon zu spät war.
Leo Trotzki hat 1929 in seinem Text "Die österreichische Krise" diese Logik der Kapitulation unbarmherzig kritisiert: "Man kann sich kaum etwas Absurderes vorstellen als Otto Bauers Argumentation, der zufolge Gewalt nur zur Verteidigung der bestehenden Demokratie angewandt werden darf. In die Sprache des Klassenkampfs übersetzt heißt das: Gewalt ist erlaubt, um die Interessen der staatlich organisierten Bourgeoisie zu verteidigen, Gewalt ist verboten, wenn es um die Errichtung eines Arbeiterstaats geht."
Im Grunde hielt die sozialdemokratische Führung an dieser Maxime fest - sie war eine zutiefst in der bürgerlichen Gesellschaft verwurzelte reformistische Partei, die es jedoch mit radikaler Phrase verstanden hatte, sich die Gefolgschaft des allergrößten Teils der Arbeitenden zu bewahren.
Charakter der österreichischen Sozialdemokratie
In der österreichischen Sozialdemokratie hatte bereits früh der Opportunismus Eingang gefunden. Mit dem Brünner Nationalitätenprogramm von 1899 ging die Partei von der Erhaltung des habsburgischen Nationalitätenstaates aus – der Zerfall in nationale Fraktionen war die Konsequenz einer Politik, die nicht das nationale Selbstbestimmungsrecht der Völker der Donaumonarchie in den Mittelpunkt stellte, sondern statt dessen einen Ausgleich mit dem Habsburger-Staat predigte. Bei den Reichsratswahlen 1911 kandidierten deutsche und tschechische Sozialdemokraten bereits gegeneinander, 1912 folgte die formelle Spaltung der Partei mit dem Austritt der tschechischen Sozialdemokratie aus allen Gremien der Gesamtpartei – die Sozialdemokratie war zerfallen, noch ehe die Monarchie aufgrund des nationalen Drucks auseinander brechen sollte.
Die von Viktor Adler und Otto Bauer nach 1900 bestimmte Politik der deutsch-österreichischen Partei (bei der der spätere Bundespräsident Karl Renner wegen seiner ungeschminkt sozialreformerischen Grundhaltung etwas am Rande stand) nahm eine besondere Physiognomie an – der Austromarxismus gab sich dabei wortradikal und nahm im Unterschied zum offenen Revisionismus eines Eduard Bernstein in Deutschland für sich in Anspruch, eine authentische Interpretation des originalen Marxismus zu sein. Trotzki, der von 1907 bis 1914 in Wien im Exil lebte und die österreichische Parteiführung wie kaum ein anderer kannte, analysierte den Austromarxismus – diese marxistisch verbrämte "Akademie der Passivität und des Ausweichens" – später als "sicherste Stütze des kapitalistischen Staates mitsamt der sich über diesem erhebenden Throne und Altare", trotz "des vorschriftsmäßigen revolutionären Phrasenschwalles".
Bei aller Übereinstimmung zwischen der Sozialdemokratie in der Habsburger-Monarchie und nach 1918 gab es allerdings zwei grundlegende Unterschiede: Erstens musste die Sozialdemokratie vor 1918 nicht den "Test der Praxis" ablegen. Die straffe Zensur, die im Weltkrieg nochmals entscheidend verschärft wurde, ließ auch den mildesten sozialdemokratischen Reformpolitiker als aufrührerisches Element erscheinen. Und bürgerliche Strömungen, die bereit gewesen wären, mit der Sozialdemokratie zu kooperieren, waren vor 1914 in weiter Ferne. Die bürgerlichen Kräfte, die der SP nach 1918 (und noch einmal verstärkt nach 1945) - um mit Hugo Portisch zu sprechen - "die Hand reichten", die gemeinsam mit der SP in einer Koalitionsregierung von 1918 bis 1920 darüber wachten, dass Österreich nicht in das "Abenteuer einer Revolution" abglitt, standen sich vor 1918 nicht nur unversöhnlich gegenüber, sondern sahen in einer Arbeiter/innen/partei nicht einmal eine ebenbürtige Gesprächspartnerin, mit der man wohl oder übel zusammenarbeiten musste, um noch Schlimmeres zu verhindern.
Und zweitens war die Sozialdemokratie vor 1914 bereits in ihre nationalen Bestandteile zerfallen - aber eine Scheidung in revolutionäre und reformistische Kräfte hatte noch nicht stattgefunden. So umfasste die deutsch-österreichische Sozialdemokratie eine große Bandbreite an politischen Strömungen: Zuerst einmal das "Parteizentrum" um Victor Adler Otto Bauer, die trotz ihrer (nicht erwiderten) Konzessionsbereitschaft gegenüber bürgerlichen Kräften die marxistische Orthodoxie für sich reklamierten. Dann ausgewiesene Rechte wie Karl Renner oder der bekennende Deutschnationale Engelbert Pernerstorfer, der ursprünglich dem deutschnationalen Kreis um Georg Ritter von Schönerer angehörte.
Und schließlich noch die Parteilinke, zu denen die "Reichenberger Linke" um ihren bekanntesten Exponenten Josef Strasser zählte. Es war sicher ein Mangel, den die österreichische Parteilinke mit der in fast allen Parteien der II. Internationale (mit wenigen Ausnahmen wie in Russland oder Bulgarien) gemein hatte: dass sie zwar die revisionistischen Strömungen und die opportunistische Praxis der Parteiführungen kritisierte, dass sie sich aber nicht zu organisatorischen Konsequenzen (was ja nicht von vorneherein den Kurs auf eine sofortige Parteispaltung hätte bedeuten müssen) bereit war. Auf diesem Boden konnte dann ja auch der gerade in der österreichischen Partei stark gepflegte Mythos der Geschlossenheit und Einheit der Partei kultiviert werden. Und die Grundlinie dieser Partei war also schon vor dem 1. Weltkrieg eine reformistische; in der 1. Republik wurde das dann eben erneut bewiesen.
Strategie und Taktik der Niederlage vom 12. Februar 1934
Sicher war der in der Partei gepflegte Einheitskult auch ein starkes Hemmnis für die Herausbildung einer starken Kommunistischen Partei in Österreich. Doch die schwache Stellung der österreichischen KP allein darauf zurückzuführen, wäre sicher verfehlt. Die KP war im November 1918 vorschnell von einem kleinen Kreis gegründet worden, der in den ersten Wochen und Monaten die Mehrheit der subjektiv Linken außerhalb der Partei beließ. Teile davon orientierten sich, wie Josef Frey, auf eine Arbeit in der Sozialdemokratie, bis sie von 1919 bis Anfang der 1920er Jahre ebenfalls die Sozialdemokratische Arbeiterpartei verließen.
So klein die Kommunistische Partei auch war, bei einer richtigen Politik, wie sie im Ansatz um 1921 mit der Einheitsfrontpolitik begonnen wurde, hätten Möglichkeiten bestanden, gegen die Konsequenzen der sozialdemokratischen Ausverkaufspolitik mobil zu machen. Die KP erkannte zwar den Charakter des Reformismus, wie er vom Austro-Marxismus gepflegt wurde, aber sie war außerstande, die Arbeitenden von der Sozialdemokratie loszubrechen. Das verhinderte nicht zuletzt die Politik des Stalinismus, die dazu führte, dass auch die österreichische Partei wie die gesamte Kommunistische Internationale nichts aus der kampflosen Niederlage gegen Hitler im Deutschland des Jahres 1933 lernte. Und so ging die damals bereits verbotene KP mit der Sozialfaschismus-Theorie in die Entscheidungsschlacht des 12. Februar 1934. Nach der behördlichen Auflösung des Republikanischen Schutzbundes am 31. März 1933 und dem Verbot der KPÖ am 26. Mai 1933 hatten sich kommunistische "Arbeiterwehrler" vor allem in Oberösterreich zwar wieder dem Schutzbund angeschlossen; aber mit einer Politik, die in der Sozialdemokratie keine reformistische Partei des Ausverkaufs der Arbeiter/innen/interessen sah, keine bürgerliche Arbeiter/innen/partei, sondern den Zwillingsbruder des Faschismus, war die Partei politisch denkbar schlecht gerüstet den 12. Februar 1934.
Natürlich war auch die Sozialdemokratie schlecht auf den 12. Februar 1934 vorbereitet. Das ist umso entlarvender, als die internationale Sozialdemokratie ja in der Spaltung der deutschen Arbeiter/innen/bewegung stets den Hauptgrund für die Niederlage gegen Hitler gesehen hatte. In Österreich waren die politisch bewusste Arbeiter/innen zu großen Teilen nach wie vor in der SP organisiert, die SP konnte also ihre politischen Konzepte ungestörter als anderswo umsetzen.
Und da muss eine eindeutige Bilanz gezogen werden. Über die Grundausrichtung war bereits weiter oben die Rede - volle 16 Jahre hatte die sozialdemokratische Parteiführung Gelegenheit um Gelegenheit ungenützt verstreichen lassen, um Ernst zu machen. Von Mal zu Mal hatten sich die Bedingungen verschlechtert. Der "Schutzbund" war bereits verboten, die "Arbeiter-Zeitung" konnte nur mehr unter strengen Auflagen erscheinen, eine Schicht der Arbeitenden nach der anderen war in der Wirtschaftskrise preisgegeben und daher einem offensiven Kampf entfremdet worden - zuletzt die Eisenbahner/innen. Die Folge des letzten Jahres der Kapitulationen von Partei- und Gewerkschaftsbürokratie war, dass große Teile der Arbeiter/innen/schaft demoralisiert den Generalstreikaufruf am Morgen des 12. Februar 1934 nicht mehr befolgten.
Doch selbst in dieser Situation hätte noch bei einer richtigeren taktischen Ausrichtung der Funken einer Chance bestanden, die Arbeiter/innen mitzureißen. Aber die ungenügende und falsche politische Vorbereitung des Kampfes drückte sich auch in seiner technischen Durchführung aus. Zuerst einmal war es ein spontaner Abwehrkampf, der ohne zentrale Leitung, ohne zentralen Plan ausbrach. Otto Bauer und der ehemalige Schutzbundkommandant Julius Deutsch, die noch während der Kämpfe in die Tschechoslowakei geflüchtet waren (letzterer mit einer Augenbinde, um eine im Kampf erlittene Verwundung vorzutäuschen), betonten immer wieder, dass ihnen der Kampf aufgezwungen worden sei - sowohl vom reaktionären Gegner als auch von der militanten Basis. Der Kampf brach daher auch nicht acht Tage zu früh oder einige Wochen zu spät aus, wie Otto Bauer im Nachhinein räsonierte, sondern um Jahre und Dutzende Gelegenheiten zu spät!
Was dem Kampf auch jede Chance auf einen Sieg nahm, war, dass er als reiner Abwehrkampf angelegt war. Das war nur natürlich, die Massen waren ja auch lange Jahre im Glauben erzogen worden, die Waffe dürfe nur zur Verteidigung von (bürgerlicher) Demokratie und Verfassung genutzt werden. Statt die Viertel der Bourgeoisie, die Zentren der Regierung anzugreifen, statt Polizeiposten und Bahnhöfe zu besetzen, verschanzten sich die Arbeiter/innen in den Wohnungen - im verzweifelten und letztlich bitter enttäuschten Kalkül, dass die Regierung die Arbeiter/innen/wohnungen nicht mit ihren überlegenen schweren Waffen, mit ihren Kanonen angreifen werde. Nur wenn die Schutzbündler die Massen mobilisieren hätten können, hätte der Funken einer Chance bestanden. Doch wofür hätten die Massen kämpfen sollen? Die SP- und Gewerkschaftsführung hatte eine Position nach der anderen preisgegeben - unter solchen Umständen musste das militärische Konzept des Schutzbundes ins Leere stoßen. Letztlich können bewaffnete Organisation der Arbeiter/innen/bewegung den Massenkampf nur ergänzen, aber nicht ersetzen.
Der Grundgedanke des Schutzbundes war es gewesen, dass der militärische Kampf zunächst von festen Punkten aus aufgenommen würde, dadurch sollten die Massen in Schwung kommen, und dann werde auch der Schutzbund zur Offensive übergehen können. Aber jeder Aufstand ist zum Scheitern verurteilt, wenn er nicht die Initiative ergreift. Statt also wie in der russischen Oktober-Revolution die strategischen Punkte zu besetzen, also gleich zu Anfang in die Offensive zu gehen, vergab der Schutzbund diese Chance, die Massen aufzurütteln. Das wäre die einzige Chance gewesen, doch noch - trotz aller politischen Grundfehler, die die Politik der SdAP über Jahre und Jahrzehnte charakterisierte - in allerletzter Minute den Aufstand zum Siege zu führen. Eine solche Ausrichtung war aber ohne Plan und ohne eine revolutionäre politische Führung nicht möglich.
Ehre den Kämpfern des 12. Februar 1934!
Einen Kampfplan hatte nur Bernaschek in Oberösterreich. Er hatte sich und seine Aktivisten seit einiger Zeit auf die Auseinandersetzung vorbereitet. Die Nachricht, dass in Linz Kämpfe begonnen hatten, sprach sich schnell herum. Spontan griff der Aufstand auf andere Städte und Industriegebiete über. Vor allem in drei Bundesländern wurde intensiv gekämpft, nämlich in Oberösterreich, Wien und der Steiermark. In Oberösterreich wurde in Linz. Steyr, Ebensee, Attnang-Puchheim und im Bergbaurevier Wolfsegg gekämpft. In Wien waren Arbeiter/innen/heime und Gemeindebauten (Karl-Marx-Hof, Goethehof, Sandleitenhof, Reumannhof und Schlingerhof) Zentren des Aufstandes. In der Steiermark wurde in Weiz, Graz, Voitsberg und etlichen Industriestädten der Mur-Mürz-Furche Widerstand geleistet; insbesondere in Bruck an der Mur, der einzigen Stadt in Österreich, wo die Arbeiter/innen (unter Führung des revolutionserfahrenen Ungarndeutschen Koloman Wallisch) zumindest vorübergehend die Macht übernahmen.
Die anderen Teile Österreich beteiligten sich allerdings kaum. In Niederösterreich gab es lediglich in Neunkirchen, Lilienfeld/Traisen und St. Pölten Widerstand, in Salzburg und Tirol gar nur in jeweils einer Stadt (in Hallein beziehungsweise Wörgl). In Vorarlberg, Kärnten und im Burgenland blieb es vollkommen ruhig. Und auch in Wien waren in etlichen Bezirken die Schutzbundkommandanten nicht zu den vereinbarten Treffen erschienen. Kampfbereite Schutzbündler irrten teilweise ohne Anweisungen und ohne Zugang zu den versteckten Waffen durch die Stadt. Der Generalstreik wurde angesichts von Repression und bereits erlebten Enttäuschungen über die zurückweichende Politik der Parteiführung kaum befolgt. Und so konnten Polizei, Bundesheer und die sie unterstützenden Heimwehrabteilungen schließlich die schlecht koordinierten, weitgehend planlosen, verzweifelt kämpfenden Schutzbundgruppen relativ leicht besiegen. Am 14. Februar streckten die letzten Aufständischen in Wien-Floridsdorf die Waffen.
In den Kämpfen wurden 128 Polizisten, Soldaten und Heimwehrler getötet, 409 von ihnen verletzt (wobei bei der Exekutive sicherlich jeder Kratzer als Verwundung gezählt wurde). Fast 200 Schutzbündler waren im Februaraufstand gefallen, mehr als 300 wurden verwundet (wobei ein Gutteil der Leichtverletzten auf Seiten der Arbeiter/innen/bewegung wohl nicht registriert wurde). Dazu kamen noch mindestens 600 tote oder verletzte Zivilist/inn/en, die durch die Exekutive in den Arbeiter/innen/vierteln umgebracht oder verwundet wurden. Vor allem der Heimwehrführer und Innenminister Emil Fey war es, der mit besonderer Härte gegen die Arbeiter/innen vorgehen ließ. Auch nach der Kapitulation wurden noch etliche Kämpfer/innen der Arbeiter/innen/bewegung exekutiert, so etwa Koloman Wallisch oder in Wien Karl Münichreiter, der gar schwer verletzt auf einer Krankenbahre zum Galgen gebracht wurde. Nach der Niederlage folgten eine Verhaftungswelle und zahlreiche Internierungen im Lager Wöllersdorf. Viele der Schutzbündler gingen nun in den Untergrund, schlossen sich nun der KPÖ oder (wie etwa Franz Drexler, Ferdinand Dworak und viele andere) dem trotzkistischen „Kampfbund" an oder formierten die linkssozialdemokratischen „Revolutionären Sozialisten".
Bei aller Kritik an der sozialdemokratischen Ausrichtung und an der (mangelnden) Organisation des Kampfes bleibt natürlich eines unumstritten: Unsere Solidarität gehört den Kämpfern, die am 12. Februar 1934 das fast aussichtslos Erscheinende, nämlich den offenen Kampf, wagten! Ehre den heldenmütigen Kämpfern des Schutzbundes und den tausenden Arbeiter/inne/n, die sich ihnen anschlossen! Ehre den gefallenen Helden! Und Ehre auch den Führern wie Bernaschek, Wallisch oder Münichreiter, die am 12. Februar 1934 kämpften!
Sie alle haben zwar nicht die Ehre der sozialdemokratischen Partei gerettet, diese hatte sich ja nicht in den Kampf geworfen, sondern diesen im Gegenteil immer wieder verhindert. Aber sie haben die Ehre des österreichischen Proletariats erhalten und eine ähnlich schmachvolle Niederlage wie in Deutschland gegen Hitler verhindert.
Aber der 12. Februar 1934 hat auch den Mythos einer kämpfenden Partei befestigt, der von der Sozialdemokratie selbst immer wieder aufs Neue genährt wurde - den Mythos einer zum Kampfe bereiten, zum Kampfe entschlossenen Partei, die auch wirklich bereit ist, für ihre Überzeugungen mit der Waffe in der Hand zur Verteidigung von Freiheit und Demokratie einzustehen. Das passt auch reaktionären Kräften: Es ist das Bild einer Sozialdemokratie, die im Angesicht des drohenden Nationalsozialismus nicht bereit war, auf die bürgerliche Demokratie zu verzichten, sich am Aufbau eines (autoritären) Ständestaates zu beteiligen und statt dessen lieber zu den Waffen gegriffen und damit dem austrofaschistischen Regime einen Zweifronten-Krieg gegen die Arbeiter/innen/bewegung und gegen Hitler aufgezwungen habe. Beides ist Unfug. Aber er hat dazu beigetragen, dass sich eine österreichische Sozialdemokratie, deren Führung ängstlich jedem Kampf ausgewichen ist, mit dem Nimbus einer Partei schmücken konnte, die konsequent nur auf eines hinarbeitet, wie es Otto Bauer in seiner unmittelbar nach der Niederlage in der Tschechoslowakei erschienenen Schrift "Der Aufstand der österreichischen Arbeiter" formulierte: "Der Tag der Vergeltung, der Tag der Revanche, der Tag des Sieges wird kommen. Am Tage des Sieges werden die österreichischen Arbeiter mit wallenden roten Fahnen zu den Gräbern unserer Gefallenen und Gerichteten ziehen, in unauslöschlicher Dankbarkeit der Helden des österreichischen Freiheitskampfes gedenkend."
Otto Bauer hat recht: Am Tage des Sieges werden die österreichischen Arbeiter mit wallenden roten Fahnen zu den Gräbern der Gefallenen und Gerichteten ziehen. Und sie werden der Helden des österreichischen Freiheitskampfes gedenken. Aber Otto Bauer hat vergessen, eines hinzuzufügen: Die österreichischen Arbeiter/innen werden auch einer Politik kritisch zu gedenken haben, die verhinderte, dass die österreichische Arbeiter/innen/klasse 1918/1919, 1927 oder 1934 die Macht ergreifen und den Kapitalismus beseitigen konnte. Und sie werden die Lehren und Schlussfolgerungen aus dieser Politik zu ziehen haben.
Manfred Scharinger
*************************************************
Literatur:
Trotzkismus in Österreich – von der Entstehung bis heute, 970 S. (in 2 Bänden),
35 €; Marxismus Nr.33
Kleine Schriftenreihe zur österreichischen Arbeiter/innen/geschichte:
Nr. 4: Texte zum 12. Februar 1934, 32 S. A4, 1,5€
Nr. 21: Kampfbund zur Befreiung der Arbeiterklasse: Broschüren (1934-1939),
114 S. A4, 9 € (mit dem Text: Die Lehren der Niederlage)