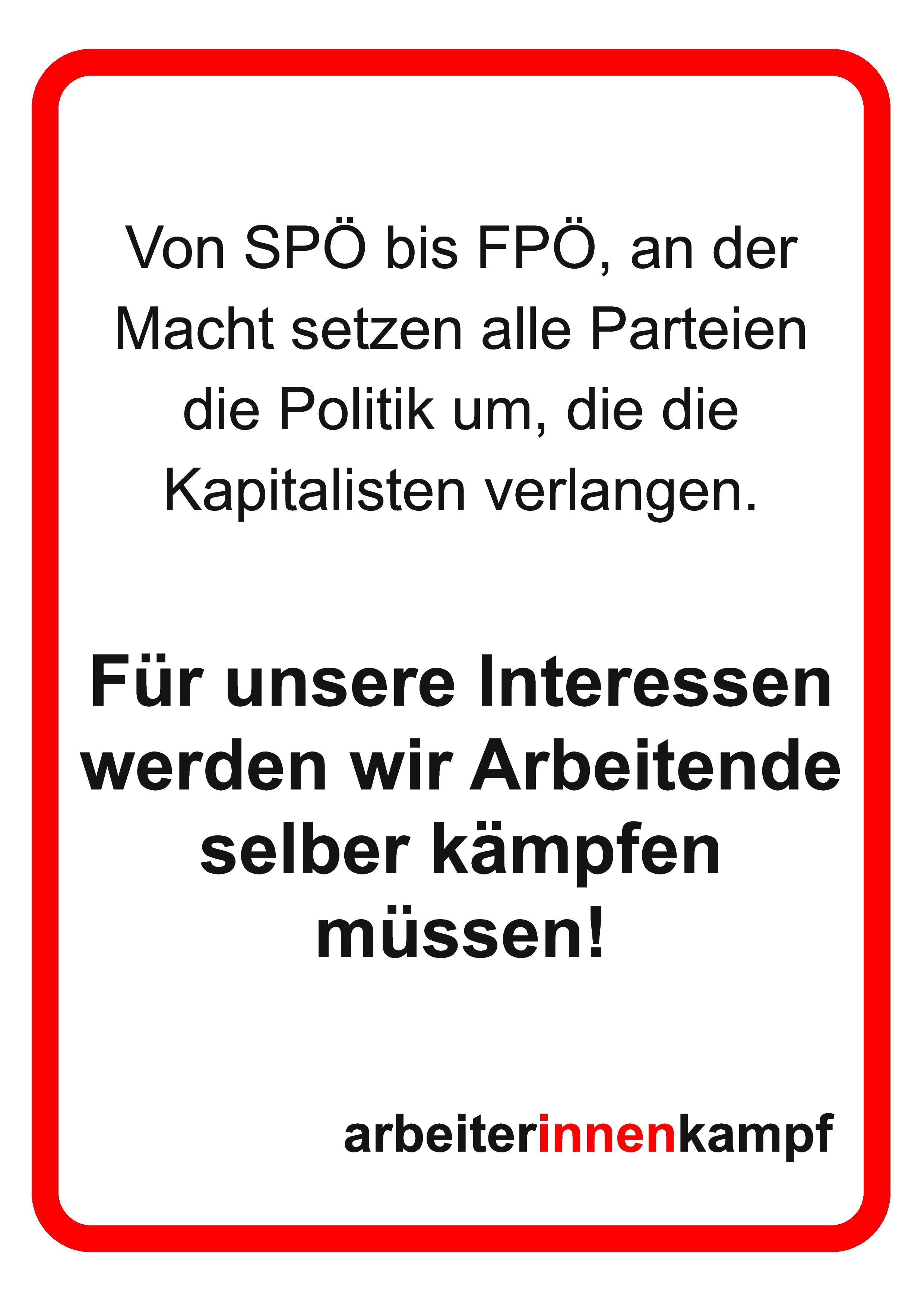Metallarbeiter/innen/streik 1962
In den 1960er Jahren gab es relativ wenige und auch nur kurze Streiks, allerdings waren daran außerordentlich viele Beschäftigte beteiligt. Der wichtigste Arbeitskampf war sicherlich der viertägige Streik der Metallarbeiter/innen im Jahr 1962. Von 9. bis 12. Mai legten (nach unterschiedlichen Angaben) zwischen 130.000 und gut 200.000 Beschäftigte der Metallindustrie und des Metallgewerbes die Arbeit nieder, um eine Lohnerhöhung und andere Verbesserungen zu erreichen.36
Von Mitte der 1950er bis Anfang der 1960er Jahre war die Produktivität in der gesamten Wirtschaft um 14% angestiegen, in der Metallindustrie sogar noch mehr. Die Beschäftigten sahen davon kaum etwas bei ihren Löhnen und bekamen die intensivierte Ausbeutung verstärkt zu spüren. Es mussten immer mehr Überstunden gemacht werden und auch die Zahl der Unfälle stieg, wie auch die sozialdemokratische „Arbeiter-Zeitung" anführte, von Jahr zu Jahr an. Angesichts dessen wuchs die Unzufriedenheit der Metallarbeiter/innen, und bereits seit Herbst 1961 hatte es in der Metallbranche mehrere „wilde" Streiks gegeben.
Die Gewerkschaftsbürokratie hatte diese Entwicklung der Stimmung in den Betrieben sehr genau beobachtet. Die sozialdemokratischen Funktionäre erkannten sehr gut die wachsende Kampfbereitschaft und sahen die Gefahr eines großen „wilden" Streiks, den sie womöglich nicht kontrollieren konnten. Dementsprechend setzten sie darauf, selbst rechtzeitig aktiv zu werden, um mit einem kontrollierten, begrenzten und gemäßigten Streik alles in den von ihnen und der herrschenden Klasse geordneten Bahnen zu halten.
Die Forderungen der sozialdemokratischen Gewerkschaftsspitzen waren deshalb, wie die „Arbeiter-Zeitung" betonte, auch „maßvoll" und bedacht auf das „Interesse unserer Wirtschaft". Franz Olah, der als Dank für seine reaktionären Bemühungen in den September/Oktoberstreiks seit 1959 Präsident des ÖGB war, jammerte am Gewerkschaftstag der Metaller/innen/gewerkschaft, „dass wir uns wochenlang bemüht haben, den Metallarbeiterstreik zu vermeiden". Da aber die Kapitalist/inn/en erst einmal stur blieben (wohl um nicht zu einfach Zugeständnisse zu machen und auch um die Kampfstimmung der Gewerkschaften zu sondieren), musste die Gewerkschaftsbürokratie den Streik ausrufen, um sich in den Belegschaften nicht zu diskreditieren und als engagierte Interessensvertretung dazustehen.39
Die ohnehin wütenden Metallarbeiter/innen waren auch wirklich bereit zu kämpfen, die Gewerkschaftsbürokratie allerdings nicht. Sie wollte nur ein paar kleine Verbesserungen herausholen, um ihren Rückhalt bei den Belegschaften abzusichern, in keiner Weise allerdings ihren grundsätzlichen sozialpartnerschaftlichen Deal mit der Kapitalist/inn/enklasse beschädigen. Dementsprechend die Anbiederungen der „Arbeiter-Zeitung" an das Kapital, dass ohnehin „auf die Erträge Rücksicht genommen" werde. Und dementsprechend haben die sozialdemokratischen Gewerkschaftsbürokrat/inn/en auch eine konsequente Durchführung des Streiks von Anfang an sabotiert.
Diese Sabotage nahm verschiedene Formen an: Erstens beschränkte die Gewerkschaftsbürokratie den Kampf auf Lohnerhöhungen, anstatt der (intensivierten) Ausbeutung den Kampf anzusagen. Zweitens hielt sie die kampfbereiten Hüttenarbeiter/innen, also die Beschäftigten der größten Betriebe (wie der VOEST) vom Streik zurück, um „der Wirtschaft" und insbesondere der sozialdemokratisch dominierten Verstaatlichten nicht zu schaden. Drittens brach sie den Streik im Metallgewerbe bereits nach zwei Tagen mit einer Einigung ab und schwächte damit den Druck auf die Kapitalist/inn/en. Viertens verkündete die Gewerkschaftsbürokratie in der „Arbeiter-Zeitung" offen, dass sie „Streikbrecher nicht am Weiterarbeiten hindern" würde.
Während Olah und Anton Benya, der Vorsitzende der Metaller/innen/gewerkschaft, so den Streikbruch zugunsten der Ausbeuter/innen/klasse billigten, warnten sie „vor Ausschreitungen und Gewaltanwendungen" – um zu verhindern, dass sich die streikenden Arbeiter/innen gegen Streikbrecher/innen und die Angriffe der Kapitalist/inn/en zur Wehr setzten. Die Folgen blieben nicht aus: In etlichen Fabriken wurde versucht, die Beschäftigten durch die Drohung mit fristloser Entlassung einzuschüchtern und so vom Streik abzuhalten. Dennoch gelang es etwa den Arbeiter/inne/n der Voith-Werke in St. Pölten, die Beschäftigten zweier kleinerer Betriebe für den Streik zu gewinnen. Repression gab es allerdings auch bei der staatlichen Elin-Union; dort wurde den Streikenden das Betreten des Betriebes verboten.
Nach vier Tagen hat die Gewerkschaftsbürokratie den Streik dann abgebrochen – weil es gewisse Zugeständnisse der Kapitalist/inn/en gab und weil sie die Ausbreitung des Streiks fürchtete. Sie wollte verhindern, dass auch die Hüttenarbeiter/innen in den Streik traten und womöglich noch die Berg- und Erdölarbeiter/innen mitrissen. Viele Metallarbeiter/innen waren für die Fortsetzung des Streiks, um zumindest die ohnehin bescheidenen Ausgangsforderungen zu erreichen. Der Unmut machte sich in Betriebsversammlungen Luft. In manchen Betrieben, vor allem in Wien, streikten die Arbeiter/innen spontan für kurze Zeit weiter.
Dass dieser Unmut verpuffte, lag freilich daran, dass die Arbeiter-/innen/klasse keine konsequent klassenkämpferischen Organisationsstrukturen hatte, dass keine revolutionäre Arbeiter/innen/organisation bestand, die eine relevante Verankerung in den Betrieben gehabt hätte. Die KPÖ, die einzige etwas größere Organisation links von der Sozialdemokratie, war selbst längst reformistisch und wollte in der stalinistischen Logik der „friedlichen Koexistenz" mit dem Kapitalismus keinen ernsthaften Kampf mit der herrschenden Klasse. Während des Metaller/innen/streiks hat sie sich, wie die KP-Zeitung „Volksstimme" offen sagte, „öffentlich jeder Kritik enthalten". Eine tatsächlich kommunistische Partei hätte nicht nur die handzahme Politik von SPÖ und ÖGB kritisieren, sondern auch die Streikenden selbst organisieren und anleiten müssen. Sie hätte versucht, in den Betrieben Streikkomitees und aus eigenen Aktivist/inn/en und anderen kämpferischen Arbeiter/inne/n eine alternative Führung aufzubauen.38
Was aber war nun das Ergebnis des Streiks? Wie sahen die Zugeständnisse der Kapitalist/inn/en aus? Die Mindestlöhne wurden um 9-12% erhöht (gefordert waren 17%), die Ist-Löhne um 4% (gefordert waren 8%); weitere 1,5% so genannte „individuelle Lohnerhöhung", die die Bosse nach „individueller Leistung" vergeben konnten – ein klassisches Spaltungsinstrument, mit dem der Egoismus gefördert wird und dem die Gewerkschaft zugestimmt hat. Mit den erreichten Lohnerhöhungen wurden nicht einmal die Preissteigerungen der letzten Jahre ausgeglichen, von einer Abgeltung für die intensivierte Arbeit ganz zu schweigen. Eine echte Verbesserung war die Abschaffung der (schlecht dotierten) „Frauenlohngruppen". Die Arbeiterinnen wurden in die Lohngruppen der Arbeiter eingereiht; auch wenn der Zusatz „entsprechend ihrer Qualifikation" in der Realität natürlich die Einreihung in die untersten Kategorien bedeutete, so war diese Änderung doch für die meisten Frauen eine Erhöhung ihres Lohnes. Dazu kamen „Kompromisse" in arbeitsrechtlichen Fragen: a) für die ersten drei Krankheitstage bekamen Arbeiter/innen nun immerhin die Hälfte des Lohnes, b) den Kapitalist/inn/en wurde lediglich „empfohlen", dass Krankheit den Urlaub unterbricht (das also, wenn man im Urlaub krank wird, diese Tage nicht als Urlaub abgezogen werden).39
Und auch die erreichten Verbesserungen konnten nicht über die kapitalistische Offensive gegen die Arbeiter/innen hinwegtäuschen, die unmittelbar nach dem Abbruch des Streiks bereits wieder an Fahrt gewann – und zwar mit Hilfe der Sozialdemokratie. SP-Vizekanzler Bruno Pittermann verlautbarte noch Mitte Mai 1962 in einem Rundschreiben an die Verstaatlichte Industrie „ein Steigern der Produktivität" (also eine weitere Intensivierung der Arbeit) und eine „Ausschaltung leistungsmindernder Faktoren" (nämlich „Rationalisierungsmaßnahmen" und die Schließung „verlustbringender Produktionszweige"). Und entgegen aller Versprechungen der Gewerkschaftsbürokratie könne es doch „Preiserhöhungen (...) nach Ausschöpfung aller anderen Möglichkeiten" geben.
36 Karlhofer 1983, S. 39, NEWS 2003 und PVÖ: Der Metallarbeiterstreik, in: Arbeiterblatt Nr. 165, Juni 1962, S. 1. Die PVÖ („Proletarische Vereinigung Österreichs") war eine Tarnorganisation des „Kampfbundes", der kleineren trotzkistischen Organisation, die auch in den 1960er Jahren noch sehr konspirativ agierte.
37 Arbeiterblatt 165, S. 1-2
38 Arbeiterblatt 165, S. 2-3
39 Arbeiterblatt 165, S. 3 und NEWS 2003