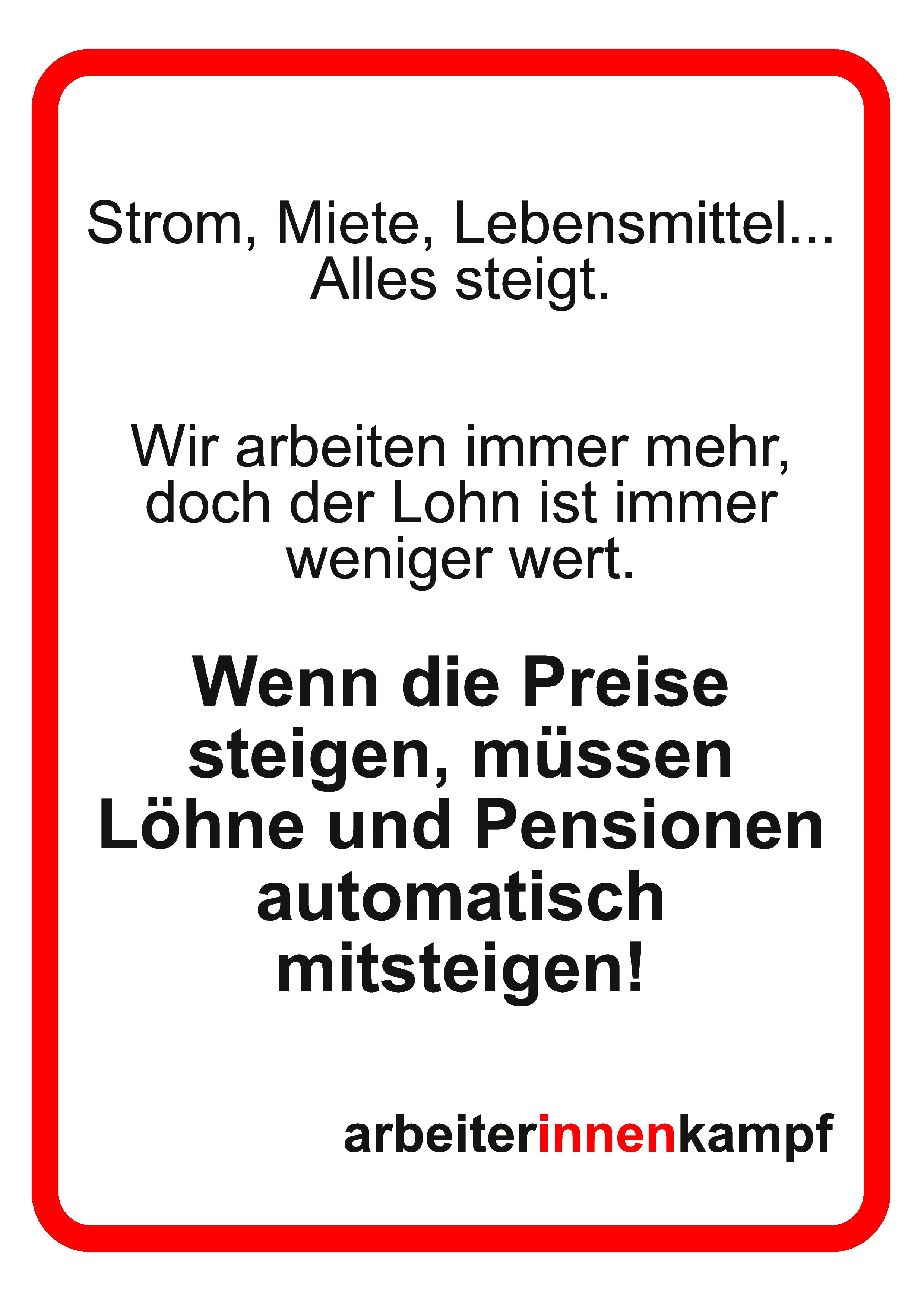VOEST Alpine Linz und Donawitz 1986
Von der internationalen Stahlkrise Anfang der 1980er Jahre war natürlich nicht nur die VEW, sondern auch ihre Muttergesellschaft, die VOEST Alpine (VA), betroffen. Schon 1981 hatte es Verluste von etwa einer Milliarde Schilling gegeben, Ende 1985 eskalierte dann die Situation um die VA-Tochterfirma Intertrading. Über diese Firma wurden die Ostgeschäfte der VA abgewickelt, also die eingetauschten Handelsgüter aus den stalinistischen Staaten weiterverkauft. Die Intertrading spekulierte aber auch am Ölmarkt und fuhr dabei Verluste von mindestens 5,7 Milliarden Schilling ein. Der für die Verstaatlichte zuständige SPÖ-Minister Ferdinand Lacina erzwang den Rücktritt des gesamten VA-Vorstandes.
Der Intertrading-Skandal wurde aber von den Kapitalist/inn/enverbänden, der ÖVP, den konservativen Medien und schließlich auch der SPÖ-Führung benutzt, um die „Entpolitisierung“, die „Sanierung“ und letztlich Privatisierung der Verstaatlichten zu propagieren. Obwohl die VOEST-Hüttenbetriebe 1985 Gewinne schrieben, wurde nun das System der Verstaatlichten Industrie frontal angegriffen – und die SPÖ unter Bundeskanzler Fred Sinowatz gab nun auch ihre halbherzige Verteidigung auf. Der SPÖ-Finanzminister Franz Vranitzky machte sich für eine „ertragsbetonte Unternehmensführung“ stark und Lacina (der später aus unerfindlichen Gründen als „linker“ SPÖler galt) profilierte sich als Verfechter von Entpolitisierung und Teilprivatisierung. Die Beschäftigten sollten also für die Spekulationsverluste der Manager bezahlen.[77]
Als in der Öffentlichkeit immer konkretere und bedrohlichere Pläne zur Zerschlagung der VA und der VEW, zu ihrer Privatisierung und zu drastischen Arbeitsplatzverlusten zirkulierten und der Unmut in den Belegschaften immer größer wurde, mobilisierten die Betriebsräte/innen für den 16. Januar 1986 zu Großdemonstrationen für den Erhalt der Verstaatlichten und gegen ihre Zertrümmerung und Privatisierung. Trotz nasskaltem Wetter waren in Linz etwa 40.000 Arbeiter/innen und in Leoben etwa 15.000 auf der Straße.
Es waren die größten Arbeiter/innen/demonstrationen, die Österreich seit den 1950er Jahren erlebt hatte. Neben den Beschäftigten der VA (in Linz damals gut 17.000, in Donawitz etwa 5.000) marschierten auch Arbeiter/innen der VEW und der Chemie Linz, Eisenbahner/innen und Postler/innen. In Linz traten die VOESTler/innen in ihrer Arbeitskleidung in nach Werkstätten und Abteilungen geordneten Blöcken auf. Sie gingen diszipliniert in Reihen und hielten jeweils einige Meter Abstand zur nächsten Abteilung. Die Stimmung war ruhig, aber entschlossen und wütend. Es war eine Machtdemonstration, mit der die Kerne der österreichischen Industriearbeiter/innen/schaft ihre Kraft zeigten. Kaum ein bürgerliches Blatt wagte es, diese eindrucksvolle Kundgebung der Arbeiter/innen zu denunzieren.
Obwohl die Stimmung aufgebracht war, stand die ganze Aktion nahezu vollständig unter der Kontrolle der sozialdemokratischen Bürokratie. Die Betriebsratsobmänner Franz Ruhaltinger (Linz) und Adolf Fauland (Donawitz), beide auch Parlamentsabgeordnete der SPÖ, donnerten zwar pflichtbewusst von der B ühne, dass mit dem Schrumpfen der VA ein Ende sein müsse, vermieden es aber peinlichst, zu den geplanten Rationalisierungskonzepten konkret Stellung zu beziehen. Sinowatz in Linz und Lacina in Leoben verneigten sich zwar vor den Versammelten und beschwichtigten von der Tribüne hinunter, machten aber gleichzeitig dezent klar, dass sie an ihren „Umstrukturierungs-“ und Teilprivatisierungsplänen festhalten würden; eine „Arbeitsplatzgarantie um jeden Preis“ könnten sie nicht abgeben.[78]
Die Kräfte links von der SPÖ (der KPÖ-nahe Gewerkschaftliche Linksblock oder Skvarca in Judenburg ebenso wie die linke Betriebsratsliste „Breitmaulfrösche“ im Angestelltenbereich der VOEST in Linz oder linksradikale Gruppierungen außerhalb der Verstaatlichten) waren letztlich zu schwach und/oder hatten keine Verankerung in den Betrieben, das Vertrauen der meisten Arbeiter/innen in „ihre“ Gewerkschafts- und Parteiführung war noch immer zu groß. Und so war diese größte Arbeiter/innen-/demonstration seit Jahrzehnten letztlich ein Dampfablassen. Die vorhandene Kraft der Belegschaften verpuffte. Die SPÖ-Führung konnte, mit Flankenschutz von Ruhaltinger und Fauland, ihr Personalabbau- und Privatisierungsprogramm ungestört durchziehen. Eine Solidaritätskonferenz für die Verstaatlichte Ende Mai 1987, an der KPÖ/GLB, etliche Linksradikale, einige Grüne und der ehemalige SPÖ-Minister Erwin Lanc teilnahmen, konnte nichts mehr bewirken; teilnahmewillige SPÖ-Betriebsrät/innen waren von der Parteiführung weitgehend erfolgreich zurückgepfiffen worden.[79]
Anfang September 1986 wurde von Lacina, mittlerweile Finanzminister der SPÖ-ÖVP-Regierung von Vranitzky, das Sanierungskonzept vorgelegt; es sah einen Arbeitsplatzverlust von 9.400 Beschäftigten vor. Bis 1992 war der Beschäftigtenstand der VA Linz tatsächlich auf etwa 10.000 reduziert, außerdem wurden der Belegschaft betriebliche Sozialleistungen von jährlich mehr als 400 Millionen Schilling weggenommen. Von 1988 bis 1991 machte die VA mehr als sechs Milliarden Schilling Gewinn. Trotzdem wurde 1992 eine weitere „Sanierung“ (mit einem weiteren Personalabbau von 500 Arbeiter/inne/n) angekündigt, um für Investoren interessant zu sein. Die SPÖ-Betriebsräte/innen, die diese ganze Entwicklung widerstandslos hinnahmen und nur einige Abfederungen ausverhandelten, konnten bei den Wahlen 1992 dennoch ihre Mehrheit auf 80% der Stimmen ausbauen. 1994/95 wurde dann mit dem Börsengang die Privatisierung der VA eingeleitet, 2003 mit dem vollständigen Verkauf abgeschlossen - an den Raiffeisen-Konzern (durch den sich die ÖVP Einfluss sicherte), die Oberbank und „ausländische Investoren“. 2012 hatte die VOEST Alpine in Österreich noch gut 11.000 Beschäftigte, etwa 9.000 in Linz und 2.300 in Donawitz.[80]
[77] Wegner 2012, S. 2 und Siegi Mattl: VOEST-Krise: Das Weltbild des Spießers, in: die linke Nr. 1/1986, S. 3
[78] Wegner 2012, S. 2, Hermann Dworczak: Schuß vor den Bug, in: die linke Nr. 2/1986, S. 4 und IKL: VOEST-Krise: Gegen reformistische „Gesundung“ - Für revolutionäre Antworten, in: Klassenfront Nr. 1/1986, S. 1
[79] Persönliche Anmerkung: Der Autor dieses Buches, Eric Wegner, der kurz zuvor als Schüler in die GRM eingetreten war und der gerade grundsätzlich den Marxismus und speziell die Arbeiter/innen/klasse als revolutionäres Subjekt für sich entdeckt hatte, nahm an der Demonstration in Linz teil und war von ihrer Kraft schwer beeindruckt. Es schien ihm, dass es jetzt wirklich losgeht mit dem Kampf des Proletariats. Zu dieser Einschätzung hat sicherlich auch beigetragen, wie leicht die GRM-Flugblätter an die Arbeiter/innen zu verteilen waren: Man musste nur am Rande eines Blockes einen Packen von ein- oder zweihundert Flugblättern „abgeben“ und innerhalb von Sekunden wurden sie im Block herumgereicht, sodass jede/r Arbeiter/in eines hatte. Wegners jugendliche Hoffnung sollte bald enttäuscht werden, denn die Arbeiter/innen nahmen zwar gerne die GRM-Flugblätter und lasen offenkundig auch interessiert ihren Inhalt, letztlich war diese „radikale Gruppe“ für sie aber zu exotisch und unbekannt – und sie vertrauten (wenn auch mit Skepsis) dann doch lieber ihren SPÖ-Betriebsrät/inn/en, die auch vor und nach den Demonstrationen da waren.
[80] Gruppe ArbeiterInnenstandpunkt: Verstaatlichte: Stahl Linz im Fadenkreuz, in: ArbeiterInnenstandpunkt Nr. 43, April 1992, S. 6 und Wegner 2012, S. 2-3