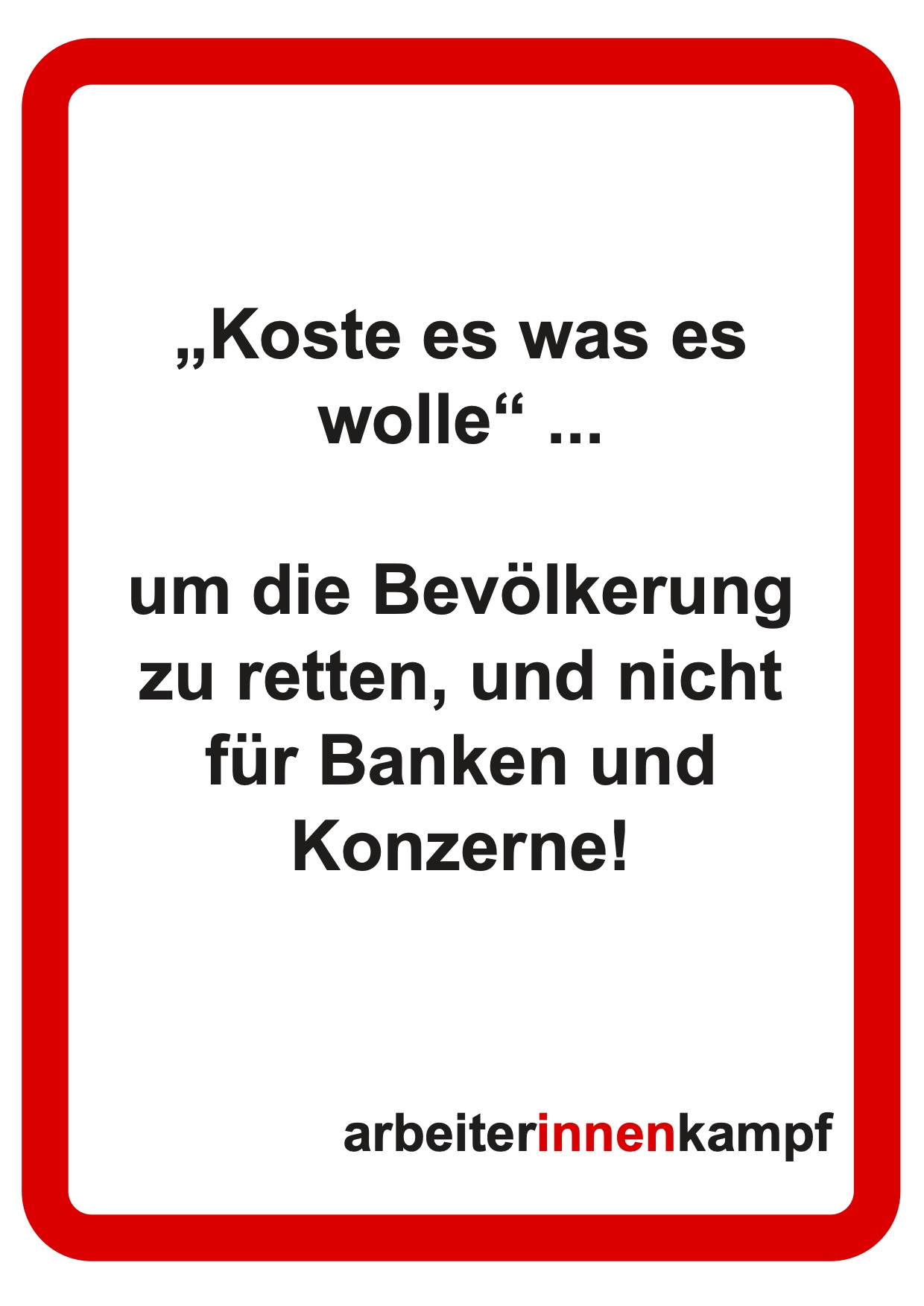Wertheim Wien 1976/77
Um die Jahreswende 1976/77 fand bei der Aufzugsfirma Wertheim in Wien-Meidling ein Arbeitskampf statt, der in den Medien kaum Erwähnung fand. Die Anzahl der Streikstunden war gering und dennoch war der Wertheim-Streik ein ganz spezieller: Er hatte eine Geschlossenheit wie kaum ein anderer in den 1970er Jahren und er wurde mit einer sehr variantenreichen Taktik geführt.
Die Wertheim AG war ein österreichisches Traditionsunternehmen, nach Kriegsende mehrheitlich in Besitz der staatlichen Kreditanstalt. 1969 stieg der schweizerische Schindler-Konzern bei Wertheim ein und dominierte sehr bald die Unternehmenspolitik. Da diese vergleichsweise konfrontativ war, kam es immer wieder zu kleineren Arbeitskämpfen. Daran Anteil hatte aber auch die politische Tradition bei Wertheim: In der 1950er und 1960er Jahren war das Betriebsratsgremium deutlich von KPÖ-Gewerkschaftler/inne/n dominiert, und auch in den 1970er Jahren fühlte sich eine Reihe von Betriebsratsmitgliedern – trotz nunmehriger SPÖ-Zugehörigkeit oder Parteilosigkeit – der (nach dem sowjetischen Einmarsch in die CSSR) von der KPÖ abgespalteten „Gewerkschaftlichen Einheit“ verbunden. Und ungeachtet ihrer fraktionellen Zugehörigkeiten pflegten die Betriebsrät/innen ein gutes Verhältnis untereinander.
1975 hatten die Beschäftigten auf innerbetriebliche Lohnforderungen verzichtet, nachdem die Firmenleitung erklärt hatte, der Betrieb sei in Schwierigkeiten. Als der Betriebsrat Mitte 1976 Einsichtnahme in die Bilanz für 1975 verlangte, wurde bekannt, dass an die Aktionäre/innen 10% Dividende ausbezahlt worden war. Da außerdem die Produktion voll ausgelastet war, verlangte der Betriebsrat nun Lohnerhöhungen. Die Firmenleitung war aber nur zu einer einmaligen Prämie von 1.300 Schilling bereit. In einer Betriebsversammlung wurde darauf die Abhaltung eines einstündigen Warnstreiks beschlossen. Etwa 360 Arbeiter/innen und Angestellte beteiligten sich daran, die Firmenleitung reagierte aber nicht.[59]
Die Belegschaft begann nun mit der Mobilisierung für den Arbeitskampf. Es wurden Aktionskomitees gewählt, und jede/r Beschäftigte zahlte, nach Einkommen gestaffelt, in einen Streikfonds ein. Ab 1. Dezember legten in jeder Abteilung jeweils einzelne Beschäftigte stundenweise die Arbeit nieder. Der Eingang und Ausgang von Waren wurde blockiert, die Produktion aber vorerst aufrechterhalten – ein Signal an die Firmenleitung, bei rechtzeitigem Einlenken keinen Schaden durch Produktionsausfall zu riskieren. Außerdem wurden sämtliche Überstunden im Betrieb eingestellt, und die Arbeiter/innen weigerten sich, ihre Uhrkarten bei Dienstbeginn und -ende zu stempeln.
Die Direktion reagierte zuerst mit einer Verwarnung und verfügte schließlich am dritten Streiktag die fristlose Entlassung der 37 Beschäftigten, die an den Punktstreiks beteiligt waren. Die Entlassungsschreiben wurden zum Betriebsrat gebracht, dieser ging, begleitet von 150 Arbeiter/inne/n, in die Direktion und gab die Briefe zurück. Entgegen der Annahme der Geschäftsführung ging der Streik nun verschärft weiter. Der Betriebsrat appellierte erfolgreich an den „gemeinsamen Zusammenhalt“, in dem „unsere größte Stärke“ bestehe.
Durch den großen Aufruhr im Betrieb und die Interventionen der Gewerkschaften der Metaller/innen und der Privatangestellten gegen die Entlassungen sah sich die Firmenleitung gezwungen, die Entlassungen zurückzunehmen. Sie verlangte dafür, dass „alle Mitarbeiter unverzüglich und im vollen Umfang ihre Arbeit wieder aufnehmen“. Sollte es weitere Arbeitsniederlegungen geben, würde das, so die Drohung, „nicht absehbare Auswirkungen auf die Arbeitsplätze“ haben. Die Belegschaft ließ sich aber weder ködern noch einschüchtern und setzte den Ausstand fort. In einer Betriebsversammlung wurde allerdings die Umwandlung des Punktstreiks in einen rotierenden Streik beschlossen. Koordiniert vom Streikkomitee, traten nun einzelne Beschäftigte verschiedener Abteilungen abwechselnd in den Streik, jeweils nur eine Stunde, um der Direktion die Abmeldung von der Sozialversicherung zu erschweren.[60]
Der Betriebsrat warf der Direktion öffentlich vor, sie sei durch ihre unnachgiebige Haltung schuld an dem Konflikt. Damit trat der Betriebsrat auch an den Vorsitzenden des Aufsichtsrates, den Generaldirektor der Creditanstalt, heran und ersuchte ihn um eine Schlichtung. Tatsächlich befasste sich der Vorstand, dem die Produktionsausfälle bei Wertheim langsam zu teuer wurden, am 14. Dezember mit der Angelegenheit. Der Kompromiss umfasste folgende Punkte: Die Firmenleitung muss Lohnerhöhungen zugestehen, dazu Neuaufnahme von Verhandlungen mit dem Betriebsrat, dafür Einstellen aller Aktionen. Mitte Februar 1977 kam schließlich eine Vereinbarung über Lohnerhöhungen zustande. Das Ergebnis wurde von der Belegschaft mehrheitlich angenommen.
Die Haltung der Gewerkschaften in diesem Arbeitskampf war zwiespältig. Die materiellen Forderungen der Streikenden wurden weder von der Metaller/innen/gewerkschaft noch von der der Angestellten unterstützt; ein betriebsbezogener Arbeitskampf sei mit den bevorstehenden KV-Verhandlungen unvereinbar. Sehr entschlossen agierten die Gewerkschaften aber für die Rücknahme der ausgesprochenen Entlassungen. Betriebsrat und Belegschaft von Wertheim waren diese Verhaltensweise der Gewerkschaften gewohnt. Es wurde zwar, sozusagen der Vollständigkeit halber, ein Antrag auf Anerkennung des Streiks gestellt. Die Anerkennung war aber nicht erwartet worden (und erfolgte auch nicht), und so beeinflusste die Haltung der Gewerkschaften das Handeln der Belegschaft nicht sonderlich.[61] Das Beispiel Wertheim zeigt jedenfalls, dass von einer entschlossenen, aktiven und kämpferischen Belegschaft, die sich entsprechende Strukturen geschaffen hat (loyaler und kämpferischer Betriebsrat, Streikkomitees), ein Streik auch ohne die Unterstützung der Gewerkschaft gewonnen werden kann.
[59] Karlhofer 1983, S. 78-80 und S. 154
[60] Karlhofer 1983, S. 80-81
[61] Karlhofer 1983, S. 81-84