Kampfbund zur Befreiung der Arbeiterklasse Broschüren (1934-1939)
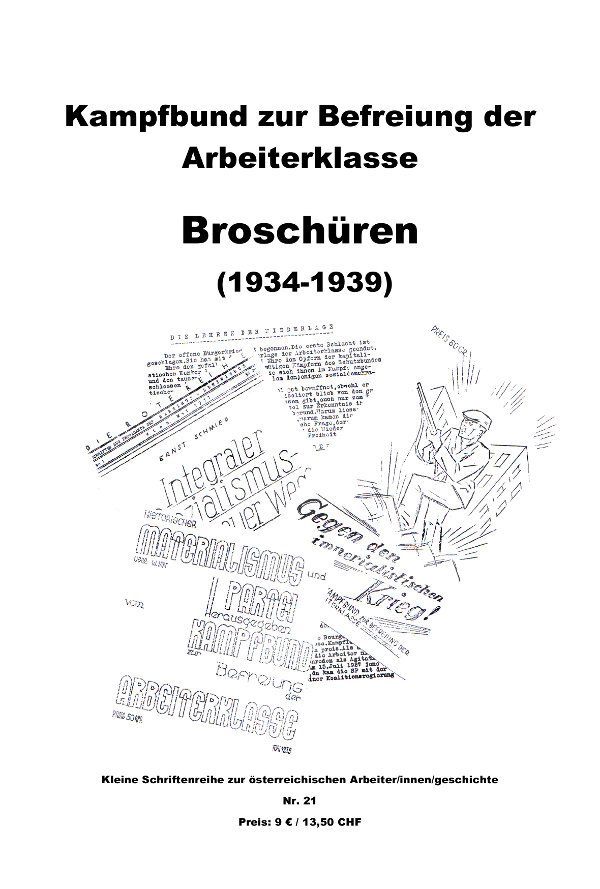
Kleine Schriftenreihe zur österreichischen Arbeiter/innen/geschichte Nr. 21
Preis: 9 €
Einleitung
von Manfred Scharinger
Der Kampfbund zur Befreiung der Arbeiterklasse, die Nachfolgeorganisation der 1933 verbotenen KPÖ (O), der Kommunistischen Partei Österreichs (Opposition), war die wichtigste linksoppositionelle Organisation in der österreichischen Illegalität ab 1934 und der Herausgeber des Zentralorgans Arbeitermacht. In der Zeit des Austrofaschismus gelang es dem Kampfbund, einen Kaderstamm nicht nur zu erhalten, sondern auch zu schulen und weiterzuentwickeln.
Dies war nicht zuletzt das Verdienst von Josef Frey, der zentralen Persönlichkeit der österreichischen linksoppositionellen Bewegung. 1882 in der heutigen Tschechischen Republik geboren, studierte er Rechtswissenschaft und arbeitete bis 1914 als Redakteur der Arbeiter-Zeitung. 1918 Vorsitzender des Wiener Soldatenrates, brach er 1920 mit der Sozialdemokratie und trat 1921 zur KPÖ über. 1927 aus dieser ausgeschlossen, war er maßgeblich an der Gründung der KPÖ (Opposition) und 1934 an der des Kampfbundes beteiligt. 1938 musste er aus politischen und „rassischen" Gründen in die Schweiz emigrieren, wo er bis zu seinem Tod 1957 lebte.
Bis heute ist die Publikationstätigkeit des Kampfbundes in der Illegalität beeindruckend. Neben der über weite Strecken monatlich erscheinenden Arbeitermacht wurden eine Reihe von Broschüren herausgegeben, daneben der Kurs, die breit angelegte Schulungsreihe unter dem Namen Marxistisch-leninistische Grundsätze des proletarischrevolutionären Kampfes, und von 1935 bis 1937 auch die Schutzbundzeitung für die Arbeit innerhalb des autonomen Schutzbundes. Mit den von uns publizierten vier Bänden der Arbeitermacht-Dokumentation, die die Jahre 1934 bis 1941 umfassen, wurden von uns alle (uns bekannten) Ausgaben der Arbeitermacht gesammelt vorgelegt. Ebenfalls im Reprint liegt die Schutzbundzeitung vor. Mit den hier neu aufgelegten vier Broschüren des Kampfbundes ist ein weiteres Stück der linksoppositionellen Publizistik in Österreich nun wieder (und in zwei Fällen erstmals legal) zugänglich.
Der erste hier aufgenommene Text, Die Lehren der Niederlage, ist mit seinen sechs Seiten am kürzesten, nimmt gleichwohl aber eine Schlüsselstellung in der Entstehungsgeschichte des Kampfbundes ein. Der Charakter der Schrift ist aus den Zeitumständen zu erklären: Unmittelbar nach der Niederlage des Schutzbundaufstandes vom 12. Februar 1934 war Josef Frey für mehrere Tage in Haft genommen worden. Sofort nach seiner Freilassung schrieb er mit den Lehren der Niederlage das erste wichtige Dokument des neu formierten Kampfbundes. Das bereits am 19. Februar 1934 auf der Gründungskonferenz angenommene Dokument war eine knappe Selbstverständigung über die Ursachen der Niederlage und die Aufgaben der Revolutionäre in der nächsten Periode. Thesenhaft wurden die Ursachen, die zur Katastrophe geführt hatten, angegeben. Damit wurden die Lehren der Niederlage ein wichtiges Propagandainstrument gegenüber sozialdemokratischen Arbeiter/inne/n. Der Text war – nach einer kurzen Einleitung, in der Frey „den gefallenen Helden" und den „heldenmütigen Kämpfern des Schutzbundes" die Ehre erwies – in drei große Abschnitte gegliedert: Die Ursachen der Niederlage, Die Perspektiven nach der Niederlage und Die Aufgaben der Arbeiterklasse.
Frey analysierte die Fehler des Aufstandes: Selbst unter Sozialdemokrat/inn/en, sofern sie sich überhaupt noch mit historischen Fragen beschäftigen, ist es heute Allgemeingut, dass schwere militärische Fehler sehr wesentlich zur Niederlage beigetragen hatten. Erforderlich wäre eine militärische Offensive gewesen. Keine Beschränkung auf die Gemeindebauten! Man hätte früher - und nicht erst mit dem Rücken zur Wand - zuschlagen sollen! Die reformistische Selbstkritik beschränkt sich damals wie heute vor allem auf militärische und taktische Fehler der Sozialdemokratie. Frey aber sah hinter dem defensiven militärischen Konzept eine ebensolche politische Strategie und Taktik des Zurückweichens. 16 Jahre Sozialdemokratie und elf Jahre Stalinismus hatten neben schweren militärischen Fehlern zum Scheitern geführt; statt „revolutionärer Massenaktion" habe es eine „militärische Aktion einer kleinen Heldenschar" gegeben. Schuld an der Niederlage war eine jahrzehntelange katastrophale Politik. Und dass die Niederlage unabwendbar wurde, war letzten Endes nur das Ergebnis des Fehlens einer „Revolutions-Partei", einer „proletarischen Klassenpartei" - das war die Grundaussage der Flugschrift und die oberste Lehre, die aus den Februarkämpfen gezogen wurde.
Das neue Regime wurde vom Kampfbund als bonapartistische Diktatur am Weg zum Faschismus eingeschätzt, die Hauptaufgabe des Proletariats die „Herausbildung der illegalen proletarischen Revolutionspartei". Im Unterschied zu KPÖ und der Nachfolgeorganisation der verbotenen Sozialdemokratie, den Revolutionären Sozialisten (RS), orientierte sich der Kampfbund von vorneherein auf eine längere Perspektive der Kadersammlung und
-ausbildung im Untergrund. Die Aufgabe des illegalen Parteiaufbaus erfordere eine „Einstellung auf längere Sicht, bei größter Ausdauer und Planmäßigkeit der Arbeit".
Gegenüber der systemtreuen Einheitsgewerkschaft empfahl der Kampfbund eine flexible Herangehensweise: Ein (vielfach vom Regime erzwungener) Eintritt sei zulässig, nicht jedoch die Übernahme von Funktionen. In der illegalen Propaganda orientierte sich der Kampfbund auf eine Einheitsfrontarbeit und auf die unmittelbaren Interessen der Massen – Arbeit und Brot, Schluss mit dem Lohnraub, Wiederherstellung der Arbeiterrechte. Um sich den nach wie vor bestehenden Illusionen in die großen Organisationen der SP nicht frontal entgegenzustellen, erklärte sich der Kampfbund richtigerweise dazu bereit, gemeinsam mit den proletarischen Massen für eine sozialdemokratische Regierung zu kämpfen, die proletarischen Revolutionäre würden sich sogar dazu verpflichten, „revolutionäre Handlungen, die über den Rahmen der breiten Demokratie hinausgehen, erst zu unternehmen, bis die Mehrheit der Arbeiterklasse bewusst für die proletarische Diktatur ist", deren Errichtung aber nach wie vor das oberste Ziel aller Anstrengungen der Arbeiter/innen/klasse bleiben müsse. Abschließend erklärte die neue Organisation:
„In dieser Richtung kämpft streng illegal der ‚Kampfbund für die Befreiung der Arbeiterklasse'. Seine Mitglieder haben die ultralinke Illusion der KP und der sozialdemokratischen Linken nicht geteilt, dass die SP überhaupt nicht kämpfen werde. (...) Sie haben in den Entscheidungstagen alle Kraft darauf konzentriert, die Massen für den Anschluss an die Schutzbundaktion zu mobilisieren. Ihre Kräfte waren zu schwach, um merklichen Erfolg zu erzielen. Aber ihre Linie war und ist auch heute die einzig richtige und auf dieser Linie kämpft der ‚Kampfbund für die Befreiung der Arbeiterklasse' konsequent in der Richtung auf das Hauptziel der Schaffung der proletarischen Revolutionspartei."
Waren die Lehren der Niederlage das entscheidende Dokument in der Entstehungsgeschichte des Kampfbundes, kam einem 1935 publizierten Dokument ebenfalls grundlegende Bedeutung zu: In einer ausführlichen, 40-seitigen Broschüre mit dem Titel Gegen den imperialistischen Krieg! legte der Kampfbund seine Position zum kommenden Krieg dar. Der Kampfbund machte sich keine Illusionen und ging von einem baldigen Ausbruch des Zweiten Weltkrieges aus. Der Überfall Japans auf China im Juli 1937 war für den Kampfbund auch schon der Auftakt zum Zweiten Weltkrieg: Dieser Krieg werde „über kurz oder lang den Krieg aller imperialistischen Räuber aufrollen".
Die allgemeine Perspektive war die Umwandlung des Krieges in den Bürgerkrieg, „die Arbeiter dürfen sich dabei nicht bange machen lassen durch die Niederlage des ‚eigenen' (kapitalistischen) ‚Vaterlands", sie müssten also „die Losung des Defaitismus" aufgreifen. Der Kampfbund fasste seine Losungen für den Kampf gegen den imperialistischen Krieg so zusammen:
„Gegen die Politik des Burgfriedens, der Landesverteidigung in allen kapitalistischen Ländern --- Für die Verteidigung der proletarischen Vaterlandes, für die Verteidigung der Sowjetmacht als proletarischer Macht durch das aktive Kampfbündnis der Arbeiter der ganzen Welt! Vorwärts zum revolutionären Sturz der Herrschaft der Bourgeoisie in allen kapitalistischen Ländern! Vorwärts zur Errichtung der Diktatur des Proletariats in allen kapitalistischen Ländern! Vorwärts zur internationalen proletarischen Revolution! Vorwärts zu den Vereinigten Sowjetstaaten Europas! Vorwärts zum die Erde umspannenden Weltbund der Sowjetrepubliken! Vorwärts zum Weltkommunismus! Schluss mit der Sozialdemokratie! Schluss mit dem Stalinismus! Schluss mit den zwei Verratsinternationalen und ihren Parteien! Gegen die sozialdemokratisch-stalinsche Schwindeleinheitsfront, Schwindeleinheit! Vorwärts zur proletarischen Einheitsfront, zur proletarischen Einheit! Vorwärts zur proletarischen Klassenpartei! Vorwärts zur Vierten Internationale!"
Dies sollte die Linie des Kampfbundes bleiben bis 1937/1938, als Frey die sogenannte kombinierte Kriegstaktik (KKT) entwickelte. Die schwere politische Krise, die diese auslöste, wurde von uns an anderem Ort ausführlich diskutiert. Bis dahin ging der Kampfbund jedenfalls vom revolutionären Defaitismus in allen imperialistischen Ländern aus, in allen Ländern sollten die proletarischen Revolutionäre auf den Sturz der kapitalistischen Herrschaft hinarbeiten. Als prinzipiell zulässig wurde eine zeitweilige Kooperation der Sowjetunion mit kapitalistischen Staaten erklärt, ebenso die Ausnützung der Gegensätze der Imperialist/inn/en. Die klare Festlegung im Sinne des revolutionären Defaitismus lautete – was 1937/1938 noch wichtig werden sollte:
„In keinem Fall darf das Zusammenarbeiten, das Bündnis der Sowjetmacht mit imperialistischen Staaten, Mächtegruppen – nicht im Frieden und erst recht nicht im Krieg – daran gebunden sein, dass die Kommunistische Partei in dem mit der Sowjetunion verbündeten kapitalistischen Staat auch nur für eine Stunde den proletarisch-revolutionären Kampf gegen die Bourgeoisie des verbündeten Staates bremst oder gar einstellt. (...) Die proletarischen Revolutionäre werden in allen Ländern – auch in jenen, die etwa ein Bündnis mit Sowjetrussland schließen! – mit ihrem revolutionären Kampf gegen die Bourgeoisie nicht eine Sekunde aufhören, der überall ausgerichtet sein muss auf den Sturz der kapitalistischen Herrschaft, auf die Errichtung der Diktatur des Proletariats."
Damit bewegte sich der Kampfbund eindeutig im Rahmen revolutionärer Prinzipien – auch die Einschränkung, dass die Revolutionäre zum Beispiel Waffentransporte aus imperialistischen Ländern für Sowjetrussland gerade im Kriegsfall nicht behindern würden, stand damit nicht im Widerspruch. Soll also eine abschließende Bewertung vorgelegt werden, kann festgehalten werden, dass der Text zum imperialistischen Krieg eine gute Grundlage für eine an revolutionären Prinzipien orientierte Politik abgab. Dass Frey selbst die Grundlage dafür legte, seine Politik am Vorabend des Zweiten Weltkriegs zu revidieren, steht auf einem anderen Blatt.
Im Mai 1937 wurde eine weitere Broschüre herausgegeben, die sich ausführlich mit Otto Bauers Buch Zwischen zwei Weltkriegen beschäftigte. Integraler Sozialismus - ein neuer Weg? Antwort an Otto Bauer ist der dritte der hier aufgenommenen Texte.
Frey, diesmal unter dem Pseudonym Ernst Schmied, anerkannte „viele richtige Tatsachen", charakteristisch aber wäre für Bauers System die Vermischung von Wahrem und Falschem, die Halbwahrheit und die vielen „Hintertürln", die sich Bauer lassen würde, um sein grundsätzliches politisches Interesse, die „Zusammenarbeit mit der Linksbourgeoisie", zu legitimieren. Die Widersprüche zeigten sich auch im Verhältnis Bauers zum kapitalistischen Staatsapparat: So würde zum einen die Unmöglichkeit, den Faschismus durch eine Koalition mit dem Bürgertum abzuwehren, und an einer Stelle sogar die Notwendigkeit der Zerschlagung des bürgerlichen Staatsapparates anerkannt. Zum anderen blieb Bauer noch immer für die Zusammenarbeit mit Teilen der Bourgeoisie offen.
Für Frey hieß das, dass es nur eine Konsequenz gebe: Die siegreiche Bauersche „demokratische Volksrevolution" würde, an die Macht gekommen, eine kleine Anzahl bürgerlicher Sündenböcke für die faschistische Vergangenheit büßen lassen, aber das System sollte ungeschoren bleiben – immerhin sprach Bauer, dem Frey große Belesenheit konzedierte, mit vollem Bewusstsein nicht wie Karl Marx vom Zerbrechen des bürgerlich-kapitalistischen Staatsapparates, sondern bewusst von der Überwindung des „bürokratisch-militärischen Staatsapparates", was nichts anderes heiße, als auf eine „Reformierung" des Staatsapparates hinzuarbeiten. Freys Konsequenz: Otto Bauer und mit ihm die Revolutionären Sozialisten, aber auch die in der grundlegenden Theorie ganz ähnliche KP mit ihrer Volksfrontpolitik, müssten sich als Hindernis auf dem Weg des Proletariats zur Macht erweisen, Bauers Politik laufe auf eine Festigung der kapitalistischen Herrschaft und Ausbeutung hinaus.
Vehement kritisierte Frey auch Bauers widersprüchliche Organisationstheorie. So würde Bauer alle Teilerfolge in der Ersten Republik der sozialdemokratischen Partei, also dem subjektiven Faktor, zuschreiben. Alle Niederlagen aber seien das unausweichliche Ergebnis objektiver Gegebenheiten – die Kleinheit Österreichs, die Feindschaft der Bauern, die Weltwirtschaftskrise und so weiter hätten keine andere Politik zugelassen. Selbst die Niederlage im Februar 1934 analysierte Otto Bauer als Ergebnis objektiver Faktoren (etwa der Waffentechnik) und nicht einer reformistischen Politik, die in die Niederlage geführt habe. Letztlich sei der integrale Sozialismus mit den „Klasseninteressen des Proletariats prinzipiell unvereinbar", das Richtige in Bauers Theorie diene wie die scheinradikale Phraseologie als „Köder", um im Proletariat zu angeln.
Mit der Kritik am Integralen Sozialismus legte der Kampfbund ein Dokument vor, das sicheres Zeugnis ablegte von seinen theoretischen Kapazitäten. Dem Kampfbund gelang es auch, sich ein – trotz Illegalität und schwierigen Kampfbedingungen – taktisch flexibles Verständnis von Einheitsfrontarbeit zu bewahren. So wurden trotz vehementer Kritik an Theorie und Praxis von Revolutionären Sozialisten und KP die Forderungen der Aktionsgemeinschaft RS/KPÖ unterstützt: Freiheitsrechte für die Arbeiter, Kampf gegen den wachsenden Terror des Regimes mit einer „Amnestie für alle antifaschistischen politischen Gefangenen", Kampf gegen die wirtschaftlichen und sozialen Verschlechterungen in den Lebensbedingungen der breiten Massen und Kampf für alle wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Forderungen der städtischen Mittelschichten und der Bauernschaft. „Selbstverständlich" würden „die proletarischen Revolutionäre den Kampf der zwei verbündeten kleinbürgerlich-radikalen Parteien für diese Losungen mit aller Kraft unterstützen". Allerdings würden sie im Unterschied zu RS und KP am Ziel der Diktatur des Proletariats festhalten.
Trotz schwieriger Bedingungen gelang dem Kampfbund also mit seiner Kritik des Integralen Sozialimus von Otto Bauer eine tief gehende Auseinandersetzung mit einem der Mentoren des austromarxistischen Reformismus. Es war schon die Stoßrichtung der Kritik Freys, dass Bauer zwar an der Oberfläche zu einer weitgehenden Revision seiner bisherigen Politik (und der der SdAP) gelange, dass er in diesem Zusammenhang viele wichtige und richtige Dinge sage, dass aber seine reformistische Grundhaltung trotz radikalerer Sprache in der Grundtendenz erhalten geblieben sei: Bauer, und mit ihm die Revolutionären Sozialisten (RS) würden nach wie vor von einer Politik der Zusammenarbeit mit den demokratischen Teilen der Bourgeoisie ausgehen und das Proletariat an seinen Klassengegner fesseln, was auch die Konsequenz stalinistischer Politik sei. Genau dieser – wie wir meinen – entscheidende Punkt kommt bei aller hie und da anklingenden Kritik auch an Bauers späten Werken Zwischen zwei Weltkriegen und Die illegale Partei zu kurz.
Otto Bauer beschränkte sich bei seinem Integralen Sozialismus auf die großen reformistischen Hauptströmungen und grenzte die revolutionären Minderheiten aus. Nicht zufällig wurde eine grundsätzliche Kritik an seinen Konzeptionen auch nur von revolutionären Positionen aus formuliert.
Für Trotzki war wie für Frey klar, dass die Wandlungen Bauers nie zu einer qualitativen Weiterentwicklung seiner Positionen geführt hatten. Otto Bauer blieb auch in der Emigration und seinen letzten großen Werken, dem Zwischen zwei Weltkriegen? oder der illegalen Partei, was er schon seit Jahrzehnten gewesen war: ein intelligenter, belesener Austromarxist, der revolutionäre Phraseologie über einen zutiefst reformistischen Inhalt stülpt.
Trotzki drückte seine politische Wertung Bauers pointiert in seiner Schrift Stalinismus und Bolschewismus so aus: „Es genügen 10 Zeilen eines x-beliebigen Hilferding oder Otto Bauer, um den Geruch der Fäulnis zu verspüren" (Trotzky, Writings 1936/37, S.417). Diesen Modergeruch des Reformismus, diese Fäulnis konkret und detailliert bei Bauer nachzuweisen, das war letztlich der Inhalt der im nachfolgenden wiederveröffentlichten Broschüre Freys.
Allerdings sollte die Kritik des Integralen Sozialismus nicht unkommentiert und unkritisch vorgestellt werden. Im wesentlichen zwei Punkte erscheinen uns kritikwürdig:
Wie alles andere, ist auch Sprache, Stil etc. in langsamer, stetiger Veränderung begriffen. Worte, Ausdrücke werden uns fremder, neue treten hinzu. Das ist natürlich, das ist gut so. Wie alles andere, so muss also auch Stil und Sprache als Produkt der Zeit und der konkreten Lebensumstände von Autor/inn/en begriffen werden. Worauf wir anspielen, ist die Tatsache, dass Frey während der Illegalität zunehmend eine Vorliebe für besonders drastische Ausdrücke entwickelte.
Es geht hier nicht darum, dass Bauers Parteitheorie als eunuchistisch bezeichnet wird, oder um den Vorwurf, dass Bauer den historischen Materialismus kastriere. Das kann in der damaligen Auseinandersetzung mit den Revolutionären Sozialisten durchaus am Platz gewesen sein.
Worum es aber geht, das ist die persönliche Kennzeichnung Bauers und der Antriebskräfte seiner politisch/theoretischen Aussagen, die zu Missverständnissen und Fehlurteilen verleiten könnte. Frey spricht von Zaubertricks, von doppelten Tricks ... zur Täuschung der Arbeiter, vom Geflunker, mit dem Bauer die Arbeiter betrügt, von Schwindeltricks und vom Köder, den er den Arbeitern zuwirft, von Lockphrasen oder schlauen Methoden und davon, dass Bauer die Rolle der Partei wegschwindelt... All das könnte dazu führen, in Bauer nichts zu sehen als einen bewussten Agenten der Bourgeoisie in den Reihen der Arbeiter/innen/bewegung und in allen seinen Aussagen nichts als bewusste Täuschungsmanöver des Proletariats. Das Problem liegt aber gerade darin, dass nur die wenigsten Parteiführer/innen ihren Anhang bewusst verraten. Bauer war zweifellos überzeugt, im Sinne seines Verständnisses von Sozialismus zu handeln und sein Buch geschrieben zu haben. Nicht sein schlechter Wille macht Bauer zum Verräter an den historischen und objektiven Interessen des Proletariats, sondern sein reformistisches Bewusstsein, seine reformistische Grundhaltung, die ihn selbst und seine Anhänger/innen – ob sie das nun wollten oder nicht, ob sie nun vom Gegenteil überzeugt waren oder nicht – an die Bourgeoisie und ihre Interessen band. Dass dazu noch ein gerüttelt Maß an Selbstrechtfertigung Otto Bauers kam, soll und kann gar nicht bestritten werden.
Das zweite Element unserer Kritik bezieht sich auf Freys ablehnende Einschätzung der Entrismus-Taktik, also des Eintritts trotzkistischer Organisationen in große Arbeiterparteien. Falsch finden wir Freys Kritik an der Bezeichnung von SP und KP als (bürgerliche!) Arbeiter/innen/parteien. Für uns ist diese Bezeichnung legitim: Der Charakter der Politik einer reformistischen Partei ist in letzter Konsequenz immer bürgerlich. Aber trotzdem wird ihre soziale Basis und das Verhältnis Arbeiter/innen/klasse – Partei ein anderes bleiben als bei anderen bürgerlichen Parteien. Genau das soll mit bürgerliche Arbeiter/innen/partei ausgedrückt werden.
Was Frey schon aus der Namensgebung folgert, sieht er in der Taktik bestätigt: Entrismus sei ein „großer Fehler" und eine „Abirrung". Der Spartakist, das Organ der illegalen Internationalen Kommunisten Österreichs (IKÖ) hielt es noch 1949 nötig, sich in dieser Frage ausdrücklich von Trotzki abzugrenzen (Nr.39/40, S.13).
Die Versuche, Kräfte für eine neue Internationale zu sammeln, hatten im Herbst 1934 zum sogenannten Entrismus geführt. Diese von Trotzki angeregte Taktik bedeutete, dass Revolutionäre in Situationen sich zuspitzender Klassenkämpfe in reformistische Parteien eintraten, um dort die Konflikte zwischen der kampfbereiten Arbeiter/innen/basis und der abwiegelnden Führung zuzuspitzen, Teile der reformistischen Arbeiter/innen/schaft für das revolutionäre Programm zu gewinnen – und quantitativ gestärkt den Bruch mit der reformistischen Führung herbeizuführen. Diese Taktik wurde in den USA und in Belgien sehr erfolgreich angewandt. In Frankreich hingegen konnte kaum davon profitiert werden. Ein Grund für den Misserfolg in Frankreich lag darin, dass der Entrismus der Ligue Communiste, der französischen Sektion der Internationalen Kommunistischen Liga, der Vorläuferin der Vierten Internationale, in die sozialdemokratische SFIO intern stark umstritten war. Generell führte die Entrismus-Taktik in der internationalen trotzkistischen Bewegung zu erheblichen Konflikten und hatte auch für die österreichische Linksopposition erhebliche Konsequenzen.
Jedenfalls war die ab 1934 von Trotzki entwickelte Taktik nicht als längerfristige Strategie, sondern eben als Taktik konzipiert, um sich Zugang zu und Gehör bei Arbeiter/inne/n, die in zentristischen oder reformistischen Massenparteien organisiert waren, zu verschaffen, sie war also an bestimmte Bedingungen geknüpft und nicht als allgemeines Konzept angelegt. Der Schritt, der in anderen Ländern ebenfalls vollzogen wurde, war gegründet auf das Ansprechen eines wichtigen Segments fortgeschrittener Elemente der Arbeiter/innen/klasse. Soweit Trotzki die Taktik beeinflussen konnte, milderten die Revolutionäre ihre Kritik an den Parteiführungen nicht ab und machten auch keine essenziellen Zugeständnisse, um in den reformistischen Parteien bleiben zu können. Es ist möglich, dass Frey viele der Diskussionen im Zusammenhang mit der Entrismus-Taktik – bedingt durch die Isolation der Illegalität – nicht oder nur unvollständig nachvollziehen konnte. Alles in allem glauben wir, dass seine Polemik gegen die Befürworter der Entrismus-Taktik, sie wären wider ihren Willen „Helfer des gesamten Schwindels der SP(RS)/KP", nicht zutreffend ist.
Die Kritik hätte an einem anderen Punkt ansetzen müssen: an der Frage der Zweckmäßigkeit der Taktik, inwieweit die einzelnen nationalen Sektionen nicht doch letztlich Zugeständnisse an einen längerfristigen Verbleib machten und ob die versprengten linksoppositionellen Organisationen politisch so gefestigt waren, um dem reformistischen Druck, der sich unzweifelhaft durch den Eintritt verstärken musste, standzuhalten. Freys Kritik setzte aber nicht da an, sondern an der Frage der prinzipiellen Zulässigkeit des Schritts - und lag damit unserer Meinung nach falsch. In der Haltung des Kampfbundes zur Entrismus-Frage 1934 lässt sich also alles in allem eine sektiererische und starre Tendenz festmachen: nämlich das schematische Anklammern am Prinzip der zeitlosen Notwendigkeit einer auch formal-organisatorisch unabhängigen revolutionären Partei.
Doch dies mindert in keiner Weise die Leistung des Kampfbundes als Herausgeber und Josef Freys als Verfasser dieser Broschüre, die auch heute noch von mehr als akademisch-historischem Interesse ist: Diese Schrift bleibt auch heute noch von politischer Wichtigkeit als fundierte, marxistische Kritik eines Zeitgenossen.
Der letzte der hier wieder als Reprint vorgelegten Texte - Historischer Materialismus und Partei - stammt aus dem Jahr 1939 und wurde unter dem Namen W. Hirt wieder von Josef Frey verfasst. Uns liegt die Broschüre in zwei Auflagen vor - eine vom April 1939 und eine zweite vom Mai 1939. Sie unterscheiden sich nicht inhaltlich, sondern im Wesentlichen in einer unterschiedlich aufwändigen Gestaltung des Titelblattes. Wir haben uns daher entschlossen, von der ersten Auflage nur die erste Seite hier wiederzugeben, uns ansonsten aber auf einen Reprint der zweiten (und endgültigen) Auflage zu beschränken.
Historischer Materialismus und Partei und war eine ausführliche Abrechnung mit der sozialdemokratischen Parteitheorie. Otto Bauer war zwar 1938 gestorben, posthum wurde in Paris aber 1939 seine Arbeit Die illegale Partei veröffentlicht. Für Frey war die hier entwickelte Parteitheorie Ausdruck von Bauers „eunuchistischer Geschichtstheorie", Bauers Buch Die illegale Partei eine „'Verbesserung' des Eunuchismus". Sprache und Stil von Josef Frey sind damit sicher gewöhnungsbedürftig. Allerdings wurde das auch schon von linksoppositionellen Zeitgenoss/inn/en so gesehen, etwa vom ehemaligen Mitglied des Kampfbundes Franz Drexler: „Du kennst den Stil, in dem Frey geschrieben hat, der Stil war ja nicht gerade gut. Aber Frey war ein ausgezeichneter Redner. Wenn man nur gelesen hat, was er geschrieben hat, ist das ein derartiger Widerspruch, wie gut er gesprochen hat. Und vor allem, wie verständlich er gesprochen hat!"
Ziel Freys war es, die Nachtrabpolitik Bauers aufzudecken, die natürlich auch seine Parteitheorie prägte. Das ist ihm auch zweifellos gelungen. Im Wesentlichen war die Broschüre damit eine Weiterführung der bereits in der Kritik des Integralen Sozialismus vorgegebenen Thematik.
Nach Kriegsbeginn publizierte der Kampfbund noch eine weitere, von Frey geschriebene Broschüre. Sie wurde im Mai 1940 herausgegeben und bestand aus der Wiedergabe eines kurze Zeit vorher mit Frey geführten (fiktiven?) Gespräches. Sie liegt uns nicht vor und dürfte auch archivalisch nicht erfasst, sondern verloren gegangen sein. Ausführliche Zitate finden sich aber im Vorposten der Proletarischen Internationalisten vom Februar 1941.
In der Kleinen Schriftenreihe haben wir bereits eine Reihe von Texten von Frey und vom Kampfbund wieder veröffentlicht. Dazu gehören: Josef Frey: Wie kämpfen gegen die Arbeitslosigkeit? (1927); Ernst Schmied (= Josef Frey): Integraler Sozialismus – ein neuer Weg? Antwort an Otto Bauer (1937); Josef Frey: Frühe Schriften (1911/19); T.J. Melt (= Josef Frey): Zur nationalen und kolonialen Frage, die Schutzbundzeitung (1935-1937) und schließlich die vier Bände der Arbeitermacht-Dokumenta-tion mit den Jahren 1934 bis 1941.
Wie schon in den bisher publizierten Bänden der Arbeitermacht- und der Schutzbundzeitung-Dokumentation sind die auch hier wieder aufgelegten Texte – bedingt durch die illegale Erscheinungsweise – in einem schlechten Zustand. Zusätzlich wurde zum Beispiel die Broschüre über den Integralen Sozialismus auf extrem dünnem Seidenpapier gedruckt, was den Transport illegalen Materials natürlich erleichtern sollte. So waren viele Seiten aller vier Texte nur schwer leserlich, für die Herausgabe war schließlich eine aufwändige digitale Aufbereitung nötig. Wir denken, mit der Neuherausgabe und der dafür gewählten Form sowohl dem Bedürfnis nach quellenmäßiger Genauigkeit als auch dem der Lesbarkeit Rechnung getragen zu haben.
Unser besonderer Dank gilt auch diesmal wieder Genossen Günter Schneider. Die Überlassung eines Teiles des Archivs des Kampfbundes hat diese Publikation maßgeblich erleichtert, ja überhaupt erst ermöglicht.
Viele Fragen konnten in diesem kurzen Vorwort nur angerissen werden. Für eine intensivere Auseinandersetzung verweisen wir abschließend auf die im Frühjahr 2012 neu erschienene zweibändige Marxismus-Ausgabe zur Geschichte des österreichischen Trotzkismus, in der sich auch eine intensive Auseinandersetzung mit dem Kampfbund und der Arbeitermacht befindet.
Wien, im August 2013
